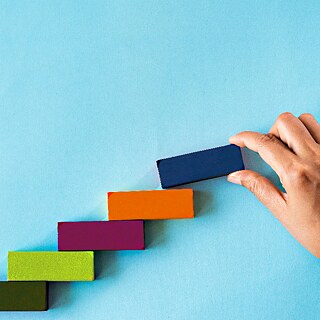Deutsch lernen
Mit Erfahrung zum Erfolg
Das Goethe-Institut bringt die deutsche Sprache in die Welt. In über 90 Ländern bieten wir Deutschkurse und Deutschprüfungen an.
Themen
Besuchen Sie uns
4 Institute in Italien
Wir fördern die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegen die internationale kulturelle Zusammenarbeit. Mehr als 150 Institute weltweit vermitteln Kultur, Sprache und Information über Deutschland. Daneben gibt es Kooperationen mit anderen Kulturgesellschaften, Bibliotheken und Sprachlernzentren.

Über uns
Kulturelle Zusammenarbeit