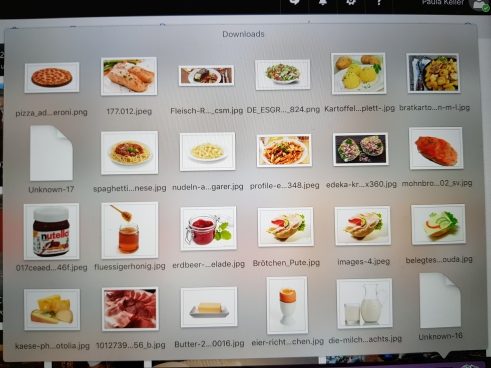Blogeintrag 4
Szenen aus dem Schulalltag
Das Schüler-Lehrer-Verhältnis
Das Verhältnis zwischen Lernenden und Lehrenden wirkt deutlich enger als in Deutschland, was aber auch daran liegen kann, dass es sich bei meiner Schule um ein Internat handelt und die Kinder von früh bis spät im Kontakt mit den Lehrenden stehen. Spontane Umarmungen sind keine Seltenheit, auch in Jahrgang sieben. Generell gibt es wenig räumliche Abschottung zwischen Lehrern und Schülern – offene Lehrerzimmer, keine Lehrertoiletten (auch der Schulleiter geht auf das Jungsklo der siebten Klassen), und gemeinsames Essen in der Schulmensa, wenn auch an Tischen, die etwas abseits stehen. Insbesondere die Grundschüler kommen aber gern herüber und erschrecken oder ärgern ihre Lehrer. Ich finde es schön und gleichzeitig überraschend, dass es keine „exklusiven“ Lehrerbereiche gibt. Dennoch hat man dadurch manchmal wenig Rückzugsmöglichkeiten, insbesondere als ausländische Lehrerin, die gerne mal belagert wird.Offene Lehrerzimmer
Überrascht hat mich das offene Lehrerzimmer. Ich habe dort schon einige Situationen erlebt, die eher als Grenzüberschreitung in Deutschland gelten würden. Die Schüler können relativ frei im Lehrerzimmer ein- und ausgehen (es gibt für jeden Jahrgang eigene Lehrerzimmer). Meistens gibt es zwar einen Grund, wie das Abholen von Büchern oder ein nachträgliches Abfragen von Englischvokabeln, aber es ist häufig der Fall, dass zumindest eine kleine Gruppe an Schülern im Raum ist. Einige von ihnen hängen den am Schreibtisch sitzenden Lehrern praktisch über der Schulter und gucken auf die Laptops. Neulich habe ich zudem beobachtet, wie drei Schüler etwas auf dem Schreibtisch eines Lehrers während seiner Abwesenheit gesucht haben. Dass das Lehrerzimmer so offen zugänglich ist und die Schüler es auch scheinbar eher als öffentlichen Raum wahrnehmen, sehe ich als starken Kontrast zu deutschen Lehrerzimmern. Hui bat in einer Unterrichtsstunde einen Schüler, ihr Handy aus der Schublade ihres Schreibtisches zu holen. Auch das kann ich mir in Deutschland kaum vorstellen. Anscheinend besteht ein großes Vertrauen zwischen Schülern und Lehrern, andererseits berichtete Hui auch schon von Diebstählen aus dem Lehrerzimmer und den Rucksäcken der Lehrer.Deutschunterricht zwischen Anspruch und Realität
Im Zwischenseminar in Peking wurde noch einmal bekräftigt, dass die Unterrichtssprache die Zielsprache (also Deutsch) sein soll. Das ist für mich erstmal nichts Neues, da es auch in der Englischdidaktik oberstes Gebot ist, dass im Englischunterricht nur Englisch gesprochen wird. In der Realität sind Übersetzungen ins Chinesische aber gang und gäbe. Da die Schüler aus ihrem Englischunterricht größtenteils nichts anderes gewohnt sind, sind große Augen und eine Art Schockstarre die Folge, wenn keine Übersetzung geliefert wird. Dennoch versuche ich, den Chinesischanteil klein zu halten, was in einigen Klassen auch gut gelingt in anderen aber eher schwer bei Hui durchzusetzen ist.Letzten Freitag habe ich zum ersten Mal zwei Stunden allein unterrichtet, weil Hui mit zwei Schülerinnen auf einer Deutscholympiade in Xi’an war. Zum Teil habe ich ein bisschen auf Englisch zurückgegriffen, aber im Grunde alles auf Deutsch erklärt. Während es in der einen Klasse reibungslos funktionierte, war die Unruhe in der zweiten (generell eher lauten Klasse) deutlich größer, wobei das Thema Farben ja durchaus anschaulich ist und man relativ leicht ohne Übersetzung auskommen kann. Was ich immer noch eher befremdlich finde, ist das Vorsagen von Wörtern und das chorische Wiederholen dieser von der ganzen Klasse. Manchmal kürze ich diesen Part unbeabsichtigt ab, aber Hui bremst mich dann aus und lässt die Schüler das Wort mindestens dreimal wiederholen. Die Schüler sind aber generell unsicher, was die Aussprache angeht, und sagen dann im Zweifel lieber gar nichts sagen. Auch wenn sie einfache Sätze bilden sollen wie „meine Lieblingsfarbe ist...“, muss/wird dieser Satz lange „geprobt“ bis die Schüler sich trauen, ihn anzuwenden. Das in Deutschland vorherrschende Motto im Fremdsprachenunterricht „fluency before accuracy“ gilt hier eindeutig nicht – eher das Gegenteil ist der Fall. Was dazu führt, dass die Schüler eben nicht besonders fließend Englisch sprechen. Mit sogenannten „Oral English“-Stunden, die dann meist von Muttersprachlern übernommen werden, wird versucht, etwas gegenzusteuern. Aber die restlichen Stunden wird von den chinesischen Englischlehrern viel Grammatik gelehrt. Als ich Hui erklärte, dass man in Deutschland eher wert darauf legt, dass man erfolgreich kommunizieren kann (das ist ja schließlich Ziel des Lernens einer Fremdsprache) und man dafür kleinere Grammatik- oder Aussprachefehler hinnimmt, erwiderte sie, dass man so ja aber keine guten Tests schreibt. Wenn diese dann auch noch über die weitere Schullaufbahn entscheiden, ist es natürlich klar, wo hier der Fokus liegt.
Ebenfalls eher ein No-Go in deutschen Klassenzimmern sind wettbewerbsorientierte Unterrichtsformen, während kooperative Formen stark gefördert werden. Hier dagegen läuft eigentlich alles über den Wettbewerbsgedanken. Innerhalb der Klasse sind die Schüler einzelnen Gruppen zugeordnet, für die sie durch gute Antworten oder schlechtes Benehmen Punkte sammeln oder verlieren können (erinnert mich ein bisschen an Harry Potter und die Strafpunkte bzw. Pluspunkte für das ganze Haus). Auch meine Gastgeschenke wie Gummibärchen wurden nicht an alle verteilt, sondern als Belohnung für die zwei bis drei besten Schüler einer Stunde eingesetzt. Zugegeben: Mein Gummibärchenvorräte hätten 9 mal 50 Schüler auch weit überstiegen, trotzdem hätte ich am liebsten jedem eines gegeben. Die Größe der Klassen ist auch immer wieder DAS Argument, warum vieles nicht geht. Gummibärchen für jeden? Zu viele Schüler. Ein Arbeitsblatt für jeden? Zu viele Schüler (mein Osterkreuzworträtsel musste zu zweit bearbeitet werden und zudem anschließend wieder ausradiert werden, damit die Zettel noch für die weiteren 8 Klassen reichen). Kooperative Unterrichtmethoden? Zu viele Schüler. Das Schaffen von Sprechanlässen gestaltet sich tatsächlich als schwieriger – aber nicht unmöglich. Der Versuch eines Kugellagers endete eher im Chaos, was auch daran lag, dass die Lernenden sich zum Teil weigerten, mit ihrem Gegenüber zu sprechen und sich immer ihren Freunden zuwandten. Auch bei Gruppenarbeiten stößt man an Grenzen. Da das Drucken und Kopieren an der Schule nur eingeschränkt möglich ist, hatte ich für eine Gruppenarbeit acht „Legespiele“ vorbereitet, die in Gruppen. á ca. sechs Schülern bearbeitet werden sollten, was schon grenzwertig war, allein vom Platz um die einzelnen Tische. Gleich in der ersten Klasse gab es aber 54 Lernenden, was die Gruppen nochmal vergrößerte. Dazu kam, dass die kleinen Zettel, die auf dem Tisch in die richtige Reihenfolge gebracht werden sollten, durch die vielen Ventilatoren in der Klasse ständig wegflogen und diese nach Einsätzen in drei verschiedenen Klassen schon arg ramponiert aussahen, aber ja noch deutlich mehr Einsätze vor sich hatten. Deswegen habe ich Hui zu DEM Lehrergadget schlechthin überredet: einer Laminiermaschine. Diese ist auch schon angekommen und wir haben schon erste Testobjekte laminiert. Die nächste Materialproduktion kann kommen!