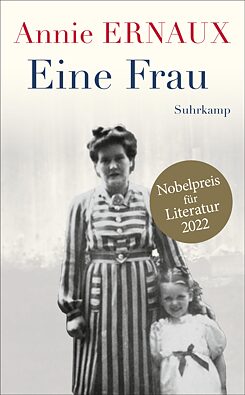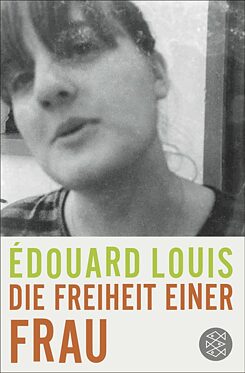Kafka verfasste seinen Brief an den Vater im Jahr 1919, mit 36 Jahren. Der Brief erreichte seinen Adressaten nie, wurde aber zum berühmten autobiografischen Kommentar. Und genau wie Kafka haben sich Dutzende Autor*innen mit den Verstrickungen ihrer Identität beschäftigt.
Denn wenn man mit unerträglichen Tatsachen konfrontiert ist – „Alle vierzig Minuten begeht jemand im Land des Käses und der Beruhigungsmittel Selbstmord. Und alle sieben Minuten wird eine Frau sexuell belästigt oder vergewaltigt“, erinnert uns die französische Schrifstellerin Chloé Delaume –, ist es besser, fliehen zu können. Für die Autorin von Pauvre folle (wörtlich: „Arme Verrückte“) ist es „unsere Pflicht, Stroh zu Gold zu spinnen, um nicht in einer Tages- oder Privatklinik zu landen.“ Schreiben heißt, die Dinge zu benennen, damit sie existieren. 1983, als ihr Vater ihre Mutter tötet, die ihn verlassen will, gibt es noch kein Wort, um Femizid zu sagen und damit auch zu denken. Wenn man sein Leben dem Schreiben widmet, schafft man sich auch einen Ort der Resilienz. Für ihre Erfahrungen findet die Autorin ein einprägsames Bild: sich „von der Realität gerädert“ zu fühlen.
Vermutlich hat sich auch Kafka so gefühlt, als er seinen berühmten Brief an den Vater schrieb. Der Text ist wie ein Koffer, in dem Dutzende kleine, scharfe Klingen sorgsam aufgereiht sind – die Worte und Taten, mit denen das Kind, der junge Mann und der Erwachsene unaufhörlich von seinem Vater gepeinigt wurde. Die Familie erscheint wie ein Resonanzkasten systemischer Gewalt, von schwarzer Pädagogik bis hin zu männlicher Brutalität. Im Bücherregal kann man Pauvre folle unweit vom Brief an den Vater einordnen.
Die Wahrheit: Eine Frage des Gefühls
Das „Ich“ verfügt über die Wahrheit, glaubt Literaturnobelpreisträgerin Annie Ernaux. Sie fasst ihre persönliche Erfahrung und insbesondere die kulturelle Kluft, die sich zwischen ihr und ihrer Herkunftsfamilie auftut, in Worte: „Ich habe mich [meines Lebens] wie eines Stoffes bedient, den es zu erforschen gilt, um eine Art gefühlsmäßige Wahrheit zu erfassen und zutage zu fördern.“Wer sagt die Wahrheit? Wer hat in welcher Hinsicht gelogen? Diese Fragen stellt sich Daniela Dröscher in Lügen über meine Mutter. Sie erforscht darin die Unschärfe der Erinnerungen, indem sie in die Rolle ihres kindlichen Alter Egos schlüpft: War das Gewicht ihrer Mutter tatsächlich der Ursprung aller Probleme, wie ihr Vater behauptete?
Die österreichische Autorin Monika Helfer hingegen steht in ihrem 2021 erschienenen Buch Vati offen dazu, dort hinzugehen, wo die Fiktion alles besser macht: „Man muss nicht alles wissen, und wenn man nicht alles weiß, kann man es beim Erzählen immer noch schöner machen, als es war, das fällt einem, wenn man alles weiß, dann viel schwerer.“ Auch diese drei Autorinnen lassen sich um Kafka herum platzieren.
Schreiben und Lesen sind politisch
Schreiben bedeutet existieren (lassen), aber auch bekämpfen. Diese Texte konfrontieren uns nicht nur mit einer Abrechnung innerhalb der Familie, sondern mit einer Gesellschaftsordnung. „Man hat mir gesagt, die Literatur dürfe niemals einem politischen Manifest ähneln, aber schon schärfe ich jeden Satz, als wäre er eine Messerklinge“, schreibt Édouard Louis in Die Freiheit einer Frau. Er erzählt darin die Geschichte seiner Mutter, die wegen des ihr zugeschriebenen Geschlechts und ihrer Klasse doppelt unterdrückt wurde.„Kunst [ist] unsere Möglichkeit […], unseren Abdruck auf der Welt zu hinterlassen, damit man uns nicht einfach auslöschen [kann]“, schreibt die afroamerikanische Autorin Leila Mottley in ihrem auf einer wahren Geschichte basierenden Roman Nachtschwärmerin. Sie erzählt von den Lebensumständen schwarzer Mädchen in Oakland und zeigt die Realität hinter den Masken. Wie Kafka die seines Vaters zeigt: „Du […] warst vielleicht fröhlicher, ehe Dich Deine Kinder, besonders ich, enttäuschten und zu Hause bedrückten (kamen Fremde, warst Du ja anders).“
Und wir sehen die Masken, wenn wir jene Texte lesen. Ganz gleich, welche Bezeichnung am Regal steht: Wir, die Leser*innen der Bücher und der Welt, haben die Wahl, wen wir lesen wollen. Wir haben die Wahl, zu wem wir sagen wollen: Ich glaube dir.
Januar 2024