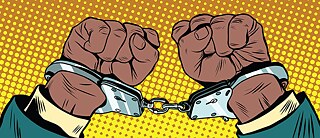Ein Interview mit Marcos Napolitano über revisionistische Tendenzen der brasilianischen Gesellschaft im Umgang mit der Militärdiktatur. In Brasilien habe die Kultur der Erinnerung an die jüngere Geschichte eine andere Stellung im Vergleich zu anderen südamerikanischen Ländern, sagt der Historiker.
Wenn auf das Militärregime in Brasilien (1964-1985) die Rede kommt, welche ist da die heute vorherrschende Erinnerung?Ich denke, wir leben noch immer unter der Vorherrschaft einer Erinnerung, die linke Erinnerung (vor allem von Kommunisten und linken Nationalisten geprägt) und liberale Erinnerung (die sich in den 1970er Jahren nach der politischen Verdrängung der Liberalen in der repressivsten Phase des Regimes bildete) vermischt. Sie basiert auf der Idee eines ökumenischen „demokratischen Widerstands“ und einer „Gesellschaft als Opfer“ der Diktatur. Ich nenne sie „vorherrschende Erinnerung“ aufgrund ihrer Präsenz in den Medien, der Kunst, im Schulsystem und in den sozialen Bewegungen beispielsweise. Doch in den letzten zehn Jahren ist diese Erinnerung Ziel eines verstärkten Revisionismus.
Die Linke, einschließlich einiger Historiker, hält es angesichts der großen Unterstützung für die Diktatur insbesondere vonseiten der Eliten und der Mittelklasse für übertrieben, in der „Demokratie“ eine universelle Achse aller Arten von Widerstand zu sehen und die Gesellschaft als „Opfer“ zu begreifen. Für die Rechte war die Diktatur allenfalls „sanft“ und verdient diesen Namen lediglich für die Zeit des Ermächtigungsparagrafen AI-5. Für die „extreme Rechte“ war sie ohnehin gut und populär mit dem einzigen Fehler, dass sie zu „sanft“ gewesen sei, was der Linken das Überleben im politischen System und in der Gesellschaft ermöglicht hätte. Letztere Position besitzt in der öffentlichen Debatte noch keine Legitimität, hat allerdings innerhalb der Gesellschaft, vor allem in den sozialen Netzwerken, an Relevanz gewonnen.
Die Gruppen, die nach einer Rückkehr der Diktatur und einem Eingreifen des Militärs rufen, wurden auch auf den Demonstrationen für das Impeachment der Präsidentin Dilma Rousseff seit 2015 gesehen.
Wie gesagt, handelt es sich um eine nostalgische Erinnerung an die Diktatur als eine Zeit des Überflusses und der öffentlichen Sicherheit. Ersteres lässt sich relativieren, denn lediglich die Konzentration der Einkommen hat zugenommen. Letzteres stützt sich auf keinerlei Fakten. Doch Erinnerung ist der Realität des Vergangenen nicht zwingend verpflichtet. Was im Übrigen ja den Unterschied zwischen Erinnerung und Geschichte ausmacht. Meiner Meinung nach steht diese Erinnerung in direkter Verbindung mit der autoritären Kultur und dem Konservatismus eines Gutteils der brasilianischen Gesellschaft, die auch über das Ende des Militärregimes hinaus sehr lebendig sind, wenn auch unsichtbar in Nischen und ohne großen Einfluss auf das kulturelle System und die ernsterzunehmenden Medien.
Kümmert sich Brasilien weniger um die Bewahrung der Erinnerung als andere südamerikanische Länder, wie etwa Argentinien, Chile oder Uruguay?
Nein, denn es gibt eine öffentliche und eine akademische Debatte im Land sowie eine zunehmende Zahl von Gedenkstätten, sehr interessanten Archivierungsansätzen, Denkmälern und anderen Initiativen. Es ist allerdings so, dass sowohl die Kultur der Erinnerung an die jüngere Vergangenheit (meist verstanden als die Erinnerung an die Diktatur) als auch die historische Erinnerung innerhalb der brasilianischen Gesellschaft an sich unterschiedliche Orte und Rollen besetzen - und auch sehr auseinanderliegende im Vergleich zu den Ländern Südamerikas -, was zur Herausbildung weniger organischer, inkohärenter und unzusammenhängender Identitäten führt.
Zum Beispiel ist es nicht außergewöhnlich, „gegen die Diktatur“ und zugleich der Ansicht zu sein „Menschenrechte nützten nur den Verbrechern“ - eine zurzeit gängige inkohärente Vermischung linker und rechter Werte.
Daher haben wir in Brasilien das Gefühl eines „Mangels an Erinnerung“. Was die Militärdiktatur angeht, gibt es ein Gemenge unzusammenhängender und miteinander in Konflikt stehender Erinnerungen: a) Eine Erinnerung der Linken (der Intellektuellen, Bewegungen und Gewerkschaften; b) eine Erinnerung der Liberalen (sehr präsent in der Presse, einigen zivilgesellschaftlichen Institutionen und im politischen System); c) eine institutionelle Erinnerung des Militärs, die als „Tabu“ (bzw.: „besser nicht mehr darüber reden) behandelt wird; d) eine Erinnerung der Rechten und Rechtsextremen, die bis vor Kurzem noch gar keinen Platz in der Öffentlichkeit hatte, jedoch stets stark in den sozialen Netzwerken war und nun sogar in der liberalen Presse und im politischen Parteiensystem Raum greift.
Welche Rolle spielte eigentlich die Presse in Bezug auf den Putsch von 1964?
Die große Presse spielt eine widersprüchliche Rolle in Bezug auf die Erinnerung an den Putsch von 1964 und das darauffolgende Regime. Bekannt, anerkannt und bewiesen ist die direkte Beteiligung der liberalen Presse an der Verschwörung und am Sturz des Präsidenten João Goulart. Doch ebenso sichtbar, wenn auch weniger bekannt, ist das selektive auf Abstand Gehen vonseiten der liberalen Presse gegenüber dem Regime, vor allem nach dem AI-5 1968. Auch schon vorher waren einige Zeitungen, die den Putsch noch befürwortet hatte, dazu übergegangen, die Diktatur zu kritisieren, wie etwa Correio da Manhã aus Rio de Janeiro, eine damals sehr wichtige Zeitung. Durch ihre Distanz zum Regime, selbst ohne jegliche Sympathie für die bewaffnete oder unbewaffnete Linke, half die Presse bei der Konstruktion einer kritischen Erinnerung, insbesondere durch die Verurteilung von Zensur und der Missachtung der Menschenrechte, von ihrer Kritik an der Staatsökonomie ab der Regierung Ernesto Geisel Mitte der 1970er Jahre ganz zu schweigen.
Doch streng genommen hat sie, was den Putsch von 1964 angeht, nie eine „ernsthafte“ Selbstkritik unternommen. Die Schuld für den Ausbruch dieses Ereignisses im Land wurde immer der „korrupten, umstürzlerischen und inkompetenten“ linken Arbeiterbewegung gegeben. Was die Berichterstattung über staatliche Gewalt angeht, kann man der Presse allerdings kein Versagen vorwerfen; sie hat stets über Folter, willkürliche Verhaftungen und Ermordungen von Aktivisten und gesellschaftlichen Anführern berichtet. Die Frage der Straflosigkeit hat nichts mit „Vergessen“ oder „Mangel an Dokumentation“ zu tun, sondern war eine politische und juristische Entscheidung der brasilianischen Eliten mit Billigung durch Teile der amnestierten Linken im Namen der politischen Stabilität nach dem Militärregime.
Welche Rolle spielen das Kino und andere Kulturformen in der Darstellung der Vergangenheit in Brasilien?
Das brasilianische Kino ist einer der wichtigsten Akteure, beispielsweise bei der Erinnerung an die Diktatur. Fiktionale Filme bewegen sich mehrheitlich entlang der „vorherrschenden Erinnerung“. Es herrscht die Regel, dass die Militärs „böse“ sind, die Guerilleros „junge Idealisten“, meist aber auch „naiv“ oder „radikal“; die Presse ist „heldenhaft“ und die Gesellschaft und der einfache Bürger sind „unschuldige Opfer“. Natürlich gibt es Nuancen, aber so ist die allgemeine Tendenz.
In Dokumentarfilmen ist die Darstellung jener Zeit komplexer, doch angesichts des aktuell in Brasilien herrschenden konservativen Revisionismus bin ich mir sicher, dass auch das Kino bald auf diesen Zug aufspringen wird. Sehen Sie nur den Erfolg von „Tropa de Elite“, der mit zugegebenermaßen hoher technischer Kompetenz Polizeigewalt zu Glamour verholfen hat. Was die Bewahrung von Erinnerung angeht, oder besser gesagt, die Konstruktion einer Erinnerung eher in Richtung einer Propagierung von Demokratie und Zivilgesellschaft, wäre der Weg meiner Ansicht nach eine Kombination von politischen Bildungsmaßnahmen, Kulturpolitiken und eines juristischen Systems, die sich der Verteidigung ideologischer, religiöser und einer Vielfalt der Lebensweisen, der zivilgesellschaftlichen Rechte und der Menschenrechte verschrieben hätten. Innerhalb dieser Parameter gäbe es keine Bedrohung der Demokratie durch die Auseinandersetzung von rechts und links in all ihren unterschiedlichen Spielarten. Doch leider wird die aktuelle Debatte so nicht geführt, sondern es wird ideologischen Hassdiskursen und Rassen- und Klassenvorurteilen sehr viel Raum eingeräumt.
 Marcos Napolitano
| Foto: Contexto Verlag
Marcos Napolitano lehrt am Historischen Institut der Universidade de São Paulo und ist Verfasser von Büchern wie „1964: História do Regime Militar Brasileiro” (Dt.: 1964: Geschichte des brasilianischen Militärregimes; editora Contexto, 2014).
Marcos Napolitano
| Foto: Contexto Verlag
Marcos Napolitano lehrt am Historischen Institut der Universidade de São Paulo und ist Verfasser von Büchern wie „1964: História do Regime Militar Brasileiro” (Dt.: 1964: Geschichte des brasilianischen Militärregimes; editora Contexto, 2014).