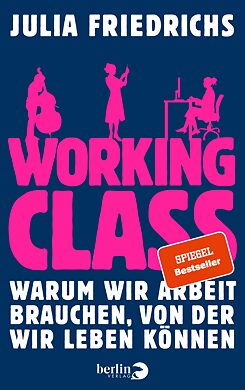Es war einmal eine Erwerbsarbeit – entfristet, sicher, erfüllend, gut bezahlt. Klingt wie ein Märchen? Warum ist das so? Und warum ist unser Berufsleben heute von so viel Unsicherheit geprägt? Die Autorin Julia Friedrichs hat dazu Menschen interviewt und über ihre Erkenntnisse der neuen Arbeitswelt ein Buch geschrieben: „Working Class“ sucht Antworten, aber übersieht auch manches Naheliegende.
Was bringt Menschen heute noch zusammen? Regionale Zugehörigkeit? Sprachen, Kultur? Vor einigen Jahren fand ein Journalist im Tagesspiegel zum 1. Mai eine gute Antwort: Es ist Arbeit oder eben der unerschütterliche Glaube an den Ruf: „Gib mir was zu tun – und bezahl’ mich dafür“. Seit Jahrhunderten ist dieser Glaube eng verzahnt mit dem Kapitalismus, aber auch Sozialismus und Kommunismus gründen auf dem Kult um die Arbeit. Es erscheint wie ein grundlegender Gesellschaftsvertrag, dass alle arbeiten sollen, ja müssen – wenn auch manchmal mehr schlecht als recht. Was aber, wenn der Glaube an die Wechselwirkung von Fleiß und Ertrag zerbricht? Dies zu beschreiben hat sich die Journalistin und Autorin Julia Friedrichs, geboren 1979 in Gronau / Westfalen, in ihrem Buch Working Class vorgenommen.Wir, die Unsichtbaren
Working Class möchte eine größere Erzählung sein rund um die Enttäuschungen darüber, wie sich die moderne Arbeitswelt in Ländern des globalen Nordens in den letzten 30 bis 40 Jahren entwickelt hat. Geprägt ist die Story auch durch die Corona-Pandemie, die bereits bestehende Probleme noch einmal vergrößert hat. Friedrichs erzählt anhand dreier Protagonisten – Alexandra, Christian und Sait. Sie sind anonymisiert, aber stehen gewissermaßen für verschiedene Arbeitswelten und deren Probleme.Alexandra und ihr Mann leben mit ihren Kindern in einem eher abgelegenen Teil einer westdeutschen Kleinstadt, beide sind freiberufliche Musiklehrer*innen, ihr Alltag stark verengt auf die Arbeit in verschiedenen umliegenden Städten für 110 verschiedene Schüler*innen. Friedrichs beschreibt die Familie als surrendes Uhrwerk, deren Geschäftigkeit dem finanziellen Druck geschuldet ist – denn wenn Alexandra und ihr Mann nicht unterrichten, verdienen sie kein Geld. Praktisch dürfen sie an keinem Arbeitstag ausfallen, geschweige denn darf eine Pandemie dazwischenkommen.
Christian ist ein nur schwer zu greifender Gesprächspartner. Er arbeitete einige Jahre in einem Unternehmen für Marktforschung, brennt dort langsam aus. Nach Mobbing in der Firma versucht er sich das Leben zu nehmen, springt vor eine U-Bahn – und überlebt. Erst in der Reha wird ihm klar, wie sehr ihn sein Job kaputtgemacht und entfremdet hat.
Sait ist der Protagonist, für den Friedrichs am meisten brennt. Er reinigt für die Berliner Verkehrsbetriebe U-Bahnhöfe, sieht täglich viel Dreck und menschliches Elend. Er ist der „ehrliche Malocher“, der sein Geld sauer mit jedem Handgriff verdient. Sait ist Sinnbild für jene, die keinen Reichtum, sondern Gerechtigkeit wollen, die sich nach einer starken Politik sehnen – und die von ihr im Stich gelassen werden.
Weitere Gesprächspartner*innen runden das Bild ab: Ein Verkäufer, der als Azubi beim Kaufhauskonzern Karstadt angefangen hat und nun als Rentner beschämt dessen Verfall mit ansehen muss; ein Kneipenwirt, der seine ganze berufliche Existenz in der Pandemie in Frage stellt; ein IT-Spezialist, der sich in einer beruflichen Abwärtsspirale verfangen hat. Kommentierend verwoben hat Friedrichs die Ergebnisse von Studien und Forscher*innen aus Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften, die nach einer Erklärung suchen, warum es für viele derart schief läuft – und warum wir den Schuss dafür scheinbar nicht gehört haben. Denn: Wie konnte es dazu kommen, dass sich in einem der reichsten Länder der Welt gut ausgebildete, fleißige Menschen trotz Vollzeitarbeit nur knapp über Wasser halten? Und warum fehlt es ihnen nicht nur an Geld und Vermögen – sondern vielmehr an Sichtbarkeit und politischer Durchsetzungskraft in der Gesellschaft?
Let’s talk about class, baby
Friedrichs zeichnet ihre Gesprächspartner*innen würdevoll, kommentiert Entscheidungen und Lebensstil praktisch nicht. Die Interviewten wohnen zur Miete oder kaufen kleine Häuser, besitzen alle Smartphones, fahren in den Urlaub, haben (gebrauchte) Autos, eine Datsche. Ihre Kinder können regelmäßig zur Schule und ihre beruflichen Pläne verwirklichen. Hier setzt eine erste Irritation ein: Das ist jetzt schon die zermürbende Unsicherheit? Wer ist diese Gruppe, die Friedrichs beschreibt? Eine „arbeitende Klasse“? Sind es „working poor“, also moderne Tagelöhner*innen?Tatsächlich beschreibt Friedrichs Menschen der erodierenden Mittelschicht, jene, die alleine vom Arbeitsnetto leben und keine Rücklagen haben – wie ein Großteil der Menschen in Deutschland. Hierzulande ist die Ungleichheit von Vermögen eine der höchsten im Euroraum – und die Abstände wachsen weiter.
Es handelt sich bei den Interviewten keinesfalls um „Arbeiter*innen“ mit einem besonderen Zusammengehörigkeitsgefühl oder gar eine „Arbeiterklasse“ – ein Begriff, den Friedrichs auch bewusst umgeht, wie sie schreibt. Zu historisierend und ideologisch besetzt ist die „Arbeiterklasse“, doch deshalb macht es der Anglizismus nicht besser. Denn eine „Klasse“ setzt – neben zahlreichen möglichen Definitionen – ein gemeinsames (politisiertes) Bewusstsein für die eigene Situation voraus und fördert kollektive Lösungen und Machtkämpfe statt individuelle. Zum Vergleich: Die „working class“-Debatten sind in Großbritannien sehr viel lebendiger. Soziale Klasse ist dort so etwas wie die lebenslange Mitgliedschaft in einem Fußballklub, die Menschen sind darin fest verankert trotz sozialer Mobilität. Die Existenz einer „Arbeiterklasse“ ist in Großbritannien sowohl akzeptiert als auch betoniert, in Deutschland hingegen versteckt sie sich eher hinter Debatten über „Bildung“ oder „Integration“. Friedrichs’ sprachlicher Schlenker ins Englische ist eher ungeschickt, denn nicht nur bleibt er unstimmig, sondern suggeriert auch, dass es in Deutschland keine sozialen Klassen (mehr) gibt.
Ihre Protagonist*innen sind zudem sehr heterogen, sie vereint allein ihre politische Unsichtbarkeit und Verunsicherung. Sie sehen sich nicht als Einheit, sind alle Individualist*innen. Sie verlassen sich wie Alexandra und ihre Familie „nur auf sich selbst“, finden eigene, auch falsche Lösungen für Probleme und haben ihre Entscheidungen weitestgehend von der Politik entkoppelt. Und: keine*r von ihnen identifiziert sich bei Friedrichs selbst als „working class“-Angehörige*r.
Das Ich gewinnt
Friedrichs sucht nach dem Kipppunkt für diesen Wandel und zappt sich – ehrlich nostalgisch – mit Serien wie Lindenstraße und Schwarzwaldklinik zurück in das Westdeutschland der 70er und 80 Jahre. Hier waren Männer noch alleinige Familienernährer, Frauen arbeiteten mehr als Hobby, am Samstagabend gab es ein Lagerfeuergefühl, wenn die gesamte Republik Wetten, dass...? schaute. Es ist auch die Zeit, in der Friedrichs aufwuchs; eine warme, als weniger komplex empfundene Zeit für die damals aufstrebende Mittelschicht; patriarchal geprägt und teils vorhersehbar bis zur Schmerzgrenze. Doch die Serien waren schon damals eher Sehnsüchte und nicht Realität, ein kurzes Innehalten vor einem Paradigmenwechsel: „In den Siebzigern waren Finanzwirtschaft und Realwirtschaft gleichauf“, so die Autorin in einem Interview. „Inzwischen ist die Finanzwirtschaft auf das Vierfache angeschwollen. Das heißt, Kapital wird wichtiger, immer mehr Menschen beziehen Einkommen aus Kapital, aber das ist halt schlecht für die, die kein Kapital haben.“ Wer wie ihre Protagonist*innen also nur von Nettogehalt zu Nettogehalt lebt, ist von langfristigem Wohlstand praktisch ausgeschlossen.Einen weiteren Aspekt beschreibt auch der Autor Philipp Sarasin in seinem Buch 1977: Die Individualisierung und „wie der Glaube an ein gemeinsames Allgemeines, der die Moderne formte, zu zerbröckeln begann“, heißt es im Klappentext. Es ist eine gedankliche Schleife, die sich bis in die Gegenwart von Alexandra, Christian und Sait zieht – der Glaube an die eigene Einzigartigkeit, das Gefühl, es alleine zu schaffen, sein Glück selbst in der Hand zu haben. Dabei verlässt man sich weniger auf Institutionen, auf Durchschnittlichkeit, auf Normierungen. Die Erzählung ist verlockend, sie begegnet einem heute permanent in den sozialen Medien („Sei du selbst!“), aber auch beim Konsum („Weil ich es mir wert bin!“) oder wenn in Stellenausschreibungen von „Talenten“ und „Persönlichkeiten“ statt „Arbeitskräften“ die Rede ist. Doch die Formel verschweigt, dass Fleiß allein nicht genügt. Erfolge bauen oft auf stillschweigend ungleich verteilten Ressourcen auf – sei es das unbezahlte, aber karriererelevante Praktikum, das man sich „leisten“ kann, die persönlichen Kontakte zu wichtigen Entscheidungsträger*innen oder die Investition in spannende Hobbys oder private Aus- und Weiterbildungen.
Für Friedrichs’ Gesprächspartner*innen hat sich ein derartiges Spiel, um am Ball zu bleiben, längst überholt. Die permanente Selbstoptimierung, um etwas „Besonderes“ zu sein und zu bleiben, können sie nicht leisten, sie sind nur bedingt ein unternehmerisches Selbst. Sie leben im aktiven Widerspruch von Flexibilität und der Sehnsucht nach Kontinuität. Besonders deutlich wird das bei Alexandra, der Musiklehrerin, denn erst die Corona-Krise bremst ihr schnurrendes Lebens-Uhrwerk und zeigt, wie prekär die Familie schon vor der Krise lebte. Trotz ihres Organisationstalentes können beide Erwachsene das unternehmerische Risiko ihrer Freiberuflichkeit eigentlich nicht stemmen. Und doch haben sie sich für diesen Weg entschieden, denn er ist eher mit mehr gesellschaftlichem Prestige verbunden, als der Minijob im Pflegebereich, den Alexandra in der Pandemie umgehend antritt. Hier besteht eine Lücke in Friedrichs’ Charakterisierungen, nämlich, dass sich der Arbeitsmarkt auch für Hochqualifizierte ausgedünnt hat – Stichwort „akademisches Prekariat“. Das macht die Sicht auf ihre „working class“ komplexer. Der Autorin dürfte dies bekannt sein, sie erwähnt es aber nicht.
 Julia Friedrichs
| Foto: © Andreas Hornoff | Piper Verlag
Julia Friedrichs
| Foto: © Andreas Hornoff | Piper Verlag
Alleine kommen wir da nicht raus
Fast allen Protagonist*innen möchte man bisweilen zurufen: Dann such’ dir doch eine andere Arbeit! Oder: Zieht doch in eine günstigere Gegend! Aber solche Appelle stammen aus derselben Ecke wie das Narrativ von „Ich schaff’ das schon alleine!“, sie laden die Verantwortung bei den Einzelnen ab. Erstaunlich ist aber, dass Friedrichs bei ihren Interviewpartner*innen keinen Veränderungswillen dokumentiert. Am Status Quo wird immer mal rumgedoktert, aber eben nicht komplett verändert – vielleicht auch, weil die Protagonist*innen ihre Entscheidungen nicht als politisch, sondern als individuell wahrnehmen. Wer könnte ihnen schon helfen? Die Parteien? Der Staat? Auch Friedrichs stellt fest: Die Protagonist*innen sitzen am kürzeren Hebel, letztlich verfügt nur der Staat über wirksame Machtinstrumente, um Veränderungen zu erzwingen – beispielsweise beim Mindestlohn oder Arbeitsschutz. Die Autorin diagnostiziert den Befragten jedoch eine latente „Staatsverachtung“, eine Entpolitisierung vor allem in guten Zeiten, wenn der Staat ihr Leben nur flankieren soll. Parteien, Gewerkschaften oder Verbände erreichen in solch einem Klima die Menschen nicht, können also dann auch nicht für sie streiten, wenn die Zeiten mal schlechter sind. Viele bleiben so in Krisen alleine oder sind überfordert von der Fülle an Entscheidungen, die sie zu ihrer Absicherung hätten treffen müssen. Krasse Beispiele wie das Brexit-Referendum von 2016 zeigen zudem, dass selbst derartig freie und mündige Entscheidungen durch Bürger*innen zunehmend von außen torpediert und manipuliert werden.Mehr Reichtum für alle – die beste aller Lösungen?
Im letzten Drittel des Buches skizziert Friedrichs die Vision einer Aussöhnung. Aus ihrer Sicht sollten gerade die Wohlhabenden und Superreichen – in Deutschland konzentrieren sich 35 Prozent des Vermögens in ihren Händen – etwas von ihrem Geld abgeben. Das kann man naiv finden, aber Friedrichs hat sich schon früher intensiv mit Eliten und Erben in Deutschland beschäftigt. Bei dieser Idee treten zwei Probleme auf. Zum einen ist unklar, wie dieses Geld abgeschöpft werden soll: Über Steuern? Spenden? Stiftungen? Was kostet es, das Geld zu verwalten? Und – wer entscheidet, wohin das Geld verteilt wird, wo es am dringendsten gebraucht wird? Verwaltet es der Staat und wie viel Einfluss haben Wohlhabende dann auf die Verteilung?Zum anderen schlägt Friedrichs vor, dass Reiche wieder „auf Sichtweite“ kommen und einen „gesellschaftlichen Muskel“ trainieren – also auch freiwillig auf einige finanzielle und gesellschaftliche Privilegien verzichten. Sie verspricht sich dadurch, dass es mehr Gemeinschaftlichkeit gibt – doch Gemeinschaft bedeutet auch, Risiken gemeinsam zu stemmen. Fraglich ist, ob man das als reicher Mensch nötig hat. Denn wo genug Geld vorhanden ist, wohnt man in den schönen Vierteln der Stadt längst nicht mehr zur Miete, lässt die Kinder vom Au-pair betreuen und schickt sie lieber auf eine Privatschule oder -Uni; man pflegt exklusive oder exotische Hobbys, mehrmals im Jahr wird Urlaub gemacht, überhaupt – die verfügbaren Finanzen für ein „gutes Leben“ sind mehr oder weniger unabhängig von dem, was man mit seiner Arbeit verdient. Wohlhabende Menschen können sich in Parallelwelten zurückziehen, in denen sie von den Problemen der weniger wohlhabenden Restbevölkerung unberührt bleiben. Der Anreiz zur Vergemeinschaftung bleibt gering, zumal auch Friedrichs dafür nicht mehr in Aussicht stellt als ein „gutes moralisches Gefühl“.
Nur eine Antwort reicht nicht
Friedrichs’ gut lesbares Buch bleibt hinter den Erwartungen an eine große Erzählung von modernen Arbeitsbedingungen zurück. Das liegt an einigen erzählerischen Schwächen und dem etwas bemühten Ehrgeiz zur Dokumentation der Corona-Ausnahmesituation. Aber auch daran, dass die Autorin einige wichtige Überlegungen nur kurz anreißt oder ganz weglässt. Einer der wesentlichsten blinden Flecke ist der Unterschied zwischen den alten und neuen Bundesländern. Beispielsweise erfasste die Globalisierung mit dem Mauerfall das gesamte wiedervereinigte Deutschland, doch die negativen Folgen spürten vor allem Ostdeutsche. Sie zitiert den Soziologen Steffen Mau: „Die ostdeutschen Arbeiter wurden zu ‚Pionieren der Prekarität‘ (…) – Vorboten der Jobnomaden, Niedriglöhner, Saisonpendlerinnen und Gelegenheitsarbeiter, die die heutige Dienstleistungsökonomie allgemein bezeichnen.“ Tatsächlich verdienen bis heute etliche der 16 Millionen Menschen in den neuen Bundesländern trotz gleicher Ausbildung weniger Geld – im Schnitt 24,7 Prozent brutto weniger als West-Kolleg*innen – oder haben längere Arbeitszeiten. Vielen bleibt dann nur übrig, wegzuziehen. Friedrichs’ Grundgedanke von einer einst so krisensicheren Mittelschicht, die heute um Vermögen, Erbschaften und Privatpleite bangt, betrifft damit überwiegend Menschen aus den alten Bundesländern und ihre Nachkommen.Ein weiterer vernachlässigter Aspekt ist der Aufstieg des von Friedrichs erwähnten Finanzkapitalismus und die Normalisierung des Niedriglohns in Deutschland. Für Niedriglohn zu arbeiten bedeutet gegenwärtig, etwas weniger als zwölf Euro brutto pro Stunde zu verdienen. Das betraf laut Eurostat im Jahr 2017 etwa 20 Prozent der Vollzeitbeschäftigten; im selben Jahr arbeiteten wiederum 34 Prozent der Menschen in Ostdeutschland im Niedriglohnbereich.
Nicht zuletzt sind es vor allem Frauen, die mit mehreren dieser Aspekte auf einmal zu ringen haben – ein weiterer Bereich, den man sich vertiefend bei Friedrichs gewünscht hätte. Denn Frauen stellen die Hälfte der Bevölkerung, haben oft gute Qualifikationen und eine hohe Bereitschaft zur geografischen Mobilität – verdienen aber trotzdem weniger aufgrund des Gender Pay Gaps. Dieser beträgt in Deutschland etwa 20 Prozent (unbereinigt) beziehungsweise sieben Prozent (bereinigt). Erstaunlich ist, dass bei Friedrichs praktisch kaum Frauen auftauchen, denn sie hätten auch gezeigt: Weibliche Erwerbsbiografien sind schon länger von jenen Fragmentierungen betroffen, mit denen die erodierende (und vor allem männliche) Mittelschicht nun finanziell und symbolisch zu kämpfen hat.
Ebenso vermisst man im Buch eine globale Perspektive, denn Friedrichs Gesprächspartner*innen leben – alles in allem – in einem sicheren, westlichen Komfort und Freiheit. Ihr Wohlstand basiert darauf, dass es anderen Menschen auf der Welt weniger gut geht, dass der Kampf um Löhne, faire Arbeitsbedingungen und würdige Lebensbedingungen keine rein lokale Frage ist. Denn es sind auch globale Öffnungen, die neue, kapitalistisch „entfesselte“ Arbeitsmodelle nach Deutschland bringen und bis zu einem gewissen Grad normalisieren – das betrifft neben der Fleischindustrie, Logistikbranche und Erntehelfer*innen auch urbane Lieferdienste und die oft prekäre Gig-Economy von Soloselbstständigen. Hier sind die Menschen völlig vereinzelt, meist einer frühindustriell anmutenden Willkür ausgesetzt, kaum organisiert – dabei hat gerade die Pandemie gezeigt, wie verletzlich Menschen als Einzelne in Krisen sind. Neben ihrer Vision der Umverteilung von Vermögen wäre auch dieser Seitenblick bei Friedrichs wünschenswert gewesen. Es braucht größere, arbeits- und sozialpolitische Anstrengungen, untermauert von gemeinschaftlich orientierter Solidarität – eben eine echte „new working class“, die sich als solche empfindet, ohne in altbackene Ideen eines historischen Sozialismus abzurutschen.
Doch das wäre vielleicht eher Stoff für ein weiteres Buch. Ihre Grundfrage verfolgt Friedrichs stringent und szenisch, fast wie das Drehbuch einer Sozial-Doku. Ihre Arbeit wirft zwar viele Fragen auf und provoziert Widerspruch, vermeidet aber Sozialromantik oder gar poverty porn – sondern zeigt, dass es keine populistische, lineare Antwort für das Thema gibt. Und das ist gut so.
Literatur
Julia Friedrichs
Working Class: Warum wir Arbeit brauchen, von der wir leben können
Berlin Verlag (2021), 320 Seiten
Julia Friedrichs
Wir Erben: Warum Deutschland ungerechter wird
Piper Taschenbuch (2016), 336 Seiten
Julia Friedrichs
Gestatten: Elite: Auf den Spuren der Mächtigen von morgen
Piper Taschenbuch (2017), 288 Seiten
Philipp Sarasin
1977: Eine kurze Geschichte der Gegenwart
Suhrkamp Verlag (2021), 502 Seiten
Owen Jones
Chavs: The Demonization of the Working Class
Verso (2016), 352 Seiten
Juli 2021