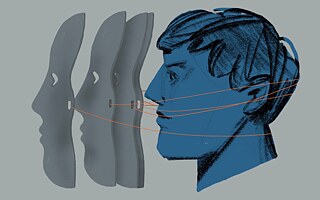Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine merken viele in der postsowjetischen Diaspora, dass sie nicht die „Russ*innen“ sind, als die sie immer wieder in Deutschland bezeichnet wurden. Ihre Identitäten sind komplex. Auch der in Kasachstan geborene Journalist Artur Weigandt will wissen: „Wer bin ich? Wer sind wir?“ In der Ukraine, eine der Heimaten seiner Vorfahren, machte er sich auf die Suche.
„Sie wurden in Uspenka geboren? Haben Sie einen ukrainischen Pass?“, fragt mich ein Grenzbeamter, während er meinen deutschen Pass mustert. „Ich wurde nicht im ukrainischen Uspenka geboren. Ich wurde im kasachischen Uspenka geboren“, antworte ich dem Beamten. Der Beamte schaut mich genau an, zieht seine Augenbrauen hoch und reicht mir den Pass aus dem kleinen Fenster seiner Stube und sagt: „Sie dürfen weiterfahren.“Dieses Uspenka existiert mindestens sechs Mal in der ehemaligen Sowjetunion. Mein Dorf Uspenka wurde in Kasachstan noch vor der russischen Revolution von ukrainischen Deportierten gegründet. Dort lebten sie, die verschiedenen Nationalitäten der Sowjetunion. „Was bleibt von diesem Lebensgefühl?“, frage ich mich seit dem Erlebnis an der Grenze.
Was von der Sowjetunion blieb: russische Sprache, Impfnarbe und Esskultur
Kasach*innen, Georgier*innen, Belarus*innen, Wolgadeutsche und Ukrainer*innen: Sie alle hatten den sowjetischen Pass. Was sie unterschied, war die Nationalität, die ihnen das Regime eintrug. Kulturen, das war ein Pullover, den sich die Sowjetunion überzog, um das Bild der Völkerfreundschaft aufrechtzuerhalten. Einmal im Jahr wurde in diesem kasachischen Uspenka der Tag der Völker gefeiert.Junge Menschen zogen sich ihre nationalen Trachten an und zeigten den Dorfbewohner*innen, welche Kulturen in diesem Dorf lebten. Nur ohne Nationalsprache: Russisch war die Sprache, die in diesem Ort gesprochen wurde. So entstand der sowjetische Mensch. Ein Mensch, der alle Kulturen in sich verbinden sollte und doch nur russifiziert wurde. Und dann verschwand die Sowjetunion Anfang der 90er Jahre: Was den Menschen blieb, war die russische Sprache, die weiße Narbe einer Pockenimpfung und ein kulinarischer Reichtum, von den usbekischen Manti bis zum ukrainischen Borschtsch.
Die Sprache, die Pockenimpfung und ihre Esskultur nahmen meine Familie in den 1990ern mit. Wie wir sind viele andere Familien der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gegangen. Bei uns war es das „Kriegsfolgeschicksal“ der Russlanddeutschen, also eine Wiedergutmachung des deutschen Angriffskrieges auf die Sowjetunion und die damit verbundene Deportation zahlreicher Russlanddeutscher. Bei anderen Familien waren es die jüdischen Wurzeln: Kontingentgeflüchtete. Mein russlanddeutscher Vater nahm meine Mutter, die in Kasachstan geboren wurde und einen kasachischen Pass hatte, mit. Wenn ich meine Mutter aber fragte, ob sie Kasachin war, antwortete sie: Sie war Belarusin und Ukrainerin.
Die russische Welt befindet sich im Rückzugsgefecht
Es ist schon spät. Ich passiere in einem blauen VW-Bus einen ukrainischen Wachposten. Das Land wurde durch die gezielten russischen Attacken auf die Energieinfrastruktur in völlige Dunkelheit gehüllt. Nach einer halben Stunde Fahrt sehe ich ein Schild an der Straßenseite: Balanda, ein ukrainischer Fluss, der den Nachnamen meines Großvaters trägt. Was bedeutet für mich die Ukraine? Mein Großvater wurde während des Zweiten Weltkriegs nach Kasachstan deportiert. Und heute ist mein Ziel Mykolajiw, die Geburtsstadt meines Großvaters.Ich öffne Instagram und sehe, wie viele in der postsowjetischen Diaspora in Deutschland ihre Wurzeln entdecken. Sie posten. Sie schreiben. Sie nehmen auf. Früher waren wir alle Russ*innen. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine befindet sich die russische Welt in einem Rückzugsgefecht und daran ist nicht die Ukraine, Belarus, Georgien oder Kasachstan Schuld. Schuld trägt die Regierung in Moskau mit ihrer unendlichen Gier nach einer russischen Totalität. In Zeiten des Krieges werden sich viele in ihrer Diaspora ihrer Identität bewusst. Viele merken, dass sie nicht die „Russ*innen“ sind, wie sie immer wieder in Deutschland bezeichnet wurden. Sie geben sich selbst Begriffe wie postsowjetische Identität oder PostOst, eine fluide Bezeichnung für diejenigen, die sich zwischen den Kulturen wiederfinden. Nicht ukrainisch, nicht belarusisch, nicht deutsch, nicht russisch aber auch alles gleichzeitig. Andere wiederum radikalisieren sich anders: Sie werden zu den Russen, zu denen und von denen die russische Propaganda spricht. Sie wünschen sich oft die Rückkehr der Sowjetunion zurück.
Am Tisch der Sowjetunion gab es Platz für jeden, auch wenn die Teller manchmal unterschiedlich gefüllt waren. Bis der Tisch zusammenbrach. Die Sowjetunion zerbrach. Geblieben ist aus dieser Zeit die Identität, das Gefühl, mehr als nur Russe, Ukrainer, Belaruse, Kasache zu sein. Selbst in Georgien oder Armenien kann ich mit alten und jungen Menschen über diese Verbundenheit sprechen. Die Euromaidan-Revolution in der Ukraine hat diese Identität für viele Menschen verändert, auch für mich, unwiderruflich. Seither verstehe ich, dass die postsowjetische Identität der Diaspora in viele einzelne Identitäten zerfällt.
Wer seine Identität verliert, verliert seine Heimat
Die Sowjetunion ist tot. Das russische Imperium ist tot. Und die russische Kultur im Ausland ist mit ihrem Streben nach Totalität und Vereinnahmung derzeit dem Untergang geweiht. Doch was ist für uns Kinder des Ostens, den postsowjetischen Migrant*innen, geblieben? Geblieben sind die Heimatlosigkeit in der deutschen Diaspora und die Suche nach neuen Orientierungsmustern. Das Streben der Ukraine, diese russische Totalität kulturell und physisch zu durchbrechen, hat in der Diaspora alles verändert und uns Fragen hinterlassen.Kann ich mich als Ukrainer oder Belaruse fühlen, wenn ich die beiden Sprachen nicht beherrsche? Kann ich mich als Deutscher fühlen, weil ich auf Deutsch schreibe und spreche? Ich blicke auf meinen Reisepass: Deutsch, aber geboren in Uspenka. „Wer bin ich? Wer sind wir?“, flüstere ich. In Lwiw steige ich in einen Zug nach Odesa, und von dort mit einem Kleinbus voller junger Soldaten nach Mykolajiw. Überall höre ich die ukrainische Sprache, dann russisch, dann die Mischform Surschyk. Ich merke: In diesem Krieg geht es nicht um Sprache. Es geht um die Freiheit, seine Identität selbst wählen zu dürfen. Identität, das ist Heimat. Wer seine Identität verliert, verliert seine Heimat.
In Mykolajiw dröhnen die Sirenen. Die Luftabwehr arbeitet. Sie wehrt wieder einen russischen Angriff ab. Ich höre Explosionen über meinem Kopf. Um mich herum kümmert es die Menschen kaum. Eine Frau dreht mit ihrem Handy und einem Ringlicht Videos für ihre Instagram-Storys. Alte Männer spielen Schach. Junge Männer rauchen Zigaretten auf einer Parkbank im Zentrum. Ich zucke zusammen, steige in ein Taxi und entschuldige mich bei dem Taxifahrer, dass ich ihn auf Russisch anspreche.
Er antwortet:
„Wir sind eine zweisprachige Stadt. Du musst dich nicht entschuldigen. Du klingst wie ein Ausländer. Wo kommst du her?“
„Ich bin in Kasachstan geboren und lebe in Deutschland“, antworte ich ihm.
„Stört es Sie, wenn ich rauche“, fragt er und zündet sich eine Zigarette an, bevor ich überhaupt antworte. „Was machst du in Mykolajiw?“, setzt er nach.
„Ich wollte unbedingt die Stadt sehen, in der mein Großvater geboren wurde“, antworte ich ihm und drücke meine Hände fest zusammen. Er blickt in den Rückspiegel.
„Willkommen in deiner historischen Heimat. Die alte Welt bricht zwar irgendwie zusammen und das ist auch gut so, aber die Geschichte, die uns verbindet, darf nicht vergessen werden“, sagt er. „Die Geschichte, die uns durch unsere Traumata verbindet, darf nicht vergessen werden“, ergänze ich.
Februar 2023