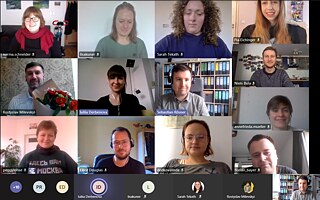Die Grenzen regionaler und nationaler Corona-Lockdowns können wir berichtende Schreiberlinge heute glücklicherweise dank digitaler Technologien überwinden. Sicherlich werden uns diese neuen Arbeitsweisen langfristig erhalten bleiben. Mit all ihren Vor- und Nachteilen: Trotz weniger analogen Kontakts müssen wir mehr digitales Miteinander schaffen.
Samstagnachmittag, mein Laptop hat sich aufgehängt. Und ich (fast) mit. Denn nein, so ein Rechner ist nicht mehr nur ein Hilfsmittel. In Zeiten der Corona-Pandemie ist dieser Bildschirm mit dem – sichtlich überforderten – Arbeitsspeicher mein Tor zur Welt. Denn in die Welt hinaus treibt es die berichtende Zunft, aus der Welt wollen wir Nachrichten und Geschichten mit zurückbringen. Doch Covid-19 verändert das Arbeiten für uns Journalist*innen gerade im Eiltempo. Und wir müssen uns schnell anpassen.Eigentlich ist es so: Wir sind dort, wo etwas passiert. Nah bei den Menschen, denen oder mit denen etwas geschieht. Für gute Geschichten müssen wir Vertrauen aufbauen – damit Protagonist*innen uns und wir unseren Informationsquellen glauben können. Wir müssen nachfragen und zuhören, begleiten und miterleben. Doch in Zeiten steigender Corona-Infektionszahlen müssen auch wir uns einschränken, um Menschen zu schützen: dienstliche Kontakte, Kolleg*innen, sich selbst und die Nächsten. Schnell könnten wir zu Superspreadern werden, treffen wir doch an verschiedenen Orten sehr unterschiedliche Menschen. Die Redaktion könnte zum Infektionsherd mutieren.
Also werden Alternativen gesucht und gefunden: Hallelujah den technischen Möglichkeiten. Um mit einer Person zu sprechen, müssen wir uns nicht zwangsläufig am selben Ort befinden. Wir können vielfältig kommunizieren, ohne unser Arbeitszimmer zu verlassen. Das geht. Macht aber vieles anders. Gewöhnungsbedürftig.
Mehr Kopfkino als Feldforschung
Zu meinen liebsten Sahnehäubchen im Journalist*innenleben zählen Recherchereisen – mit dem Ziel, tiefgründig, vielseitig und intensiv an einem bestimmten Thema zu arbeiten. Besonders mehrtägige Projekte sind mit Tagesredaktionsalltag nicht immer kompatibel. Darum nehme ich dafür gern Urlaub. Kein Problem. Hier treffen wir auf Gleichgesinnte, so macht das Erforschen besonders viel Spaß. Solche Recherchereisen organisiert beispielsweise die Deutsche Gesellschaft e.V. Für den Corona-Herbst 2020 war eine Tour zu LGBT-Themen in die Ukraine geplant, mit Besuchen bei Politikern, NGOs und Wissenschaftler*innen. Sie wurde nun meine erste digitale Recherchereise.Statt des Katers vom abendlichen Get-together mit Kolleg*innen und Aktiven vor Ort stellen sich nun viereckige Augen und Rückenschmerzen von langen Online-Meetings ein. Ein gutes Dutzend Schreiberlinge sitzt vor Bildschirmen und schaut neugierig in die Kameras. Organisatoren moderieren. Technische Schwierigkeiten lassen das Bild verpixeln und den Ton rauschen. Speaker vor Ort werden zugeschaltet. Wer Nachfragen hat, klickt auf den Hand-heben-Button. Der Ablauf ist sehr geordnet, niemand kann sich ins Wort fallen. Die Beiträge werden für den internen Gebrauch mitgeschnitten, Screenshots sind die neuen Notizen.
Einerseits sind und bleiben wir uns fremd. Der informelle Teil besteht aus kurzen Chat-Episoden über Arbeitsalltag und geplante Projekte. Praktisch, aber kühl. Während wir von unseren Schreibtischen die Herbstsonne sehen, berichten uns die ukrainischen Teilnehmenden vom ersten Schnee auf der Straße. Das Kopfkino ersetzt das direkte Erleben.
Die neue Nähe der digitalen Recherche
Gleichzeitig sind wir uns dank der Video-Konferenz viel schneller viel näher, als es auf einer analogen Recherchereise der Fall wäre. Denn wir alle sitzen in unserer heimeligen Umgebung. Niemand von uns hat künstliche Hintergründe eingestellt. Die sichtbaren Details formen unser Bild voneinander: Kleiderständer, Bücherregale, Foto- und Schrankwände, Küchenmöbel oder rote Ledersofalehnen verbinden wir mit den neuen Bekannten.Diese neue intime Ebene des Kennenlernens betrifft auch Interviews: Manche Gesprächspartner*innen nutzen ihr Smartphone für Video-Treffen. Und tragen mich mit durch ihre Wohnung. Ich sehe selbst gezeichnete Comics an den Wänden oder Katzen, die die Tapete abreißen, Kinderplüschtiere und Superheldenposter. In der analogen Welt bedurfte es oft eines längeren Kennenlernens, um Protagonist*innen so privat zu erleben. Dank der digitalen Möglichkeiten geht das schneller.
Doch dann fehlt das authentische Illustrationsbild. Auf der Ukraine-Reise wollte ich in einem Fotoprojekt Personen und Persönlichkeiten der queeren Community porträtieren. Während ich in Deutschland sitze und die Menschen vor Ort im Video-Call kennenlerne, kann ich aber maximal stark verpixelte Screenshots machen. Klar, auch das kann ein stimmungsvolles Format sein. Aber an Artikelbilder werden höhere Ansprüche gestellt.
Was also tun? Fotograf*innen vor Ort involvieren: aber dann müssen auch sie erst ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Oder ich bin auf mehr Mitarbeit der Interviewten angewiesen: Ich bitte sie, per Handy-Kamera selbst Bilder zum Erzählten zu machen. Sie müssen an bestimmte Orte fahren, Bilder auf bestimmte Weise machen und sie mir schicken. Nicht alle haben ihre Versprechen erfüllt, denn online ist es einfacher zu verschwinden. Aber ich bin erstaunt über die doch große Bereitschaft mitzumachen! Auch wenn die gesandten Bilder nie ganz meinen Vorstellungen entsprechen, sind sie doch echt und passend. Natürlich, denn die Person, um die es geht, hat sie gemacht. Und gleich noch mehr von sich preisgegeben.
Kein Virus im ländlichen Raum
Dennoch: Nach wenigen Tagen digitaler Recherche vermisse ich meine Arbeit in der Lokalredaktion einer Tageszeitung, obwohl auch hier Corona viel verändert. Die große Angst aller ist: Was tun, wenn plötzlich die ganze Redaktion erkrankt? Der Druck wächst. Wir machen also viel mehr Telefonarbeit. Und plötzlich ganz neue Themen. Denn Veranstaltungen fallen aus, Einrichtungen sind geschlossen. Viele regelmäßige und verlässliche Berichte brechen weg. Stattdessen bestimmen die täglichen Corona-Infektionszahlen den Betrieb, in Ostbrandenburg kommt die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest hinzu. Die Vogelgrippe nähert sich aus dem Norden.Wenn es dann doch einen persönlichen Termin gibt – am besten vor Ort, draußen, auf Dörfern, mit echten Menschen, ohne Bildschirme und Telefone: Das ist schon ein Fest. Durchatmen, die Geschichte erleben statt nur gesichtslosen Worten zu lauschen. Einerseits kann man sich im dünner besiedelten, ländlichen Raum eher noch persönlich treffen. Die Infektionszahlen sind niedrig. Interviews und Begehungen finden draußen statt, den Schutzabstand einzuhalten ist kein Problem.
Gleichzeitig mutet die in Dörfern noch vorherrschende Sorglosigkeit beunruhigend an. „Darf ich Ihnen noch die Hand geben?“, wird da verschmitzt gefragt. Oder kurz eingewiesen: „Bei uns hier braucht man keine Masken.“ Als wären die ostbrandenburgischen Dörfer so schlecht in die Infrastruktur eingebunden, dass sie nicht mal ein Virus erreichen könnte. So ist es nicht, und das zeigen auch die Zahlen, die uns im Herbst den zweiten Lockdown bescheren. Die Wochen-Inzidenzwerte auf 100.000 Einwohner liegen auch hier anhaltend weit über der Grenze von 50, meist auch über 100. Nicht umsonst sind die jüngsten Einschränkungen nach einigen Wochen der regionalen Umsetzung doch auf das gesamte Land ausgeweitet worden.
Ein zweiter Lichtblick, das Homeoffice mal wieder verlassen zu können, sind (noch) Sitzungen politischer Gremien. Und Demonstrationen. Dafür muss man vor Ort sein, denn Emotionen, wie sie beispielsweise bei den Protesten gegen das verschärfte Abtreibungsverbot in Polen freiwerden, kann man nicht nachtelefonieren. Entweder hingehen, oder seinlassen.
Die Welt in meinem Wohnzimmer
Sicherer ist aber das Homeoffice. Und das mausert sich langsam zu einem absolut verrückten Ort: Hier sind das Wohnen, das Zuhause, das Umfeld – zusätzlich ziehen die lokalen Geschichten und digitalen Recherchen, ehrenamtliches Engagement sowie private Kommunikation in alle Regionen Welt ein. Im Arbeitsbereich meines Wohnzimmers liegt nun Beeskow gleich bei Kiew, Bischkek unweit von Słubice, Prag und Moskau neben Minsk und Almaty. Pfeift ein Windzug morgens beim Lüften durch die Wohnung, fliegen sie alle durcheinander. In etwa so sieht es dann auch in meinem Kopf aus.Digitale Arbeitsweisen sind eine riesige Hilfe, keine Frage. Und die erzwungene Nutzung in der Pandemie-Zeit wird sie sicher langfristig zu einer unserer Gewohnheiten machen. Aber das verlangt auch viel von uns: Disziplin, Strukturierung, Zeit- und Themen-Management. Und bessere Vernetzung: Wenn wir nicht einfach irgendwohin fahren können, um vor Ort Protagonist*innen und ihre Geschichten zu entdecken, brauchen wir verlässliche Kontakte. Viel mehr Vertrauen und Mitarbeit - mit Kolleg*innen und Protagonist*innen. Wir berichten jetzt miteinander.
Dezember 2020