Erinnerung im Film
„Nicht sprechen bedeutet vergessen, und vergessen heißt wiederholen“
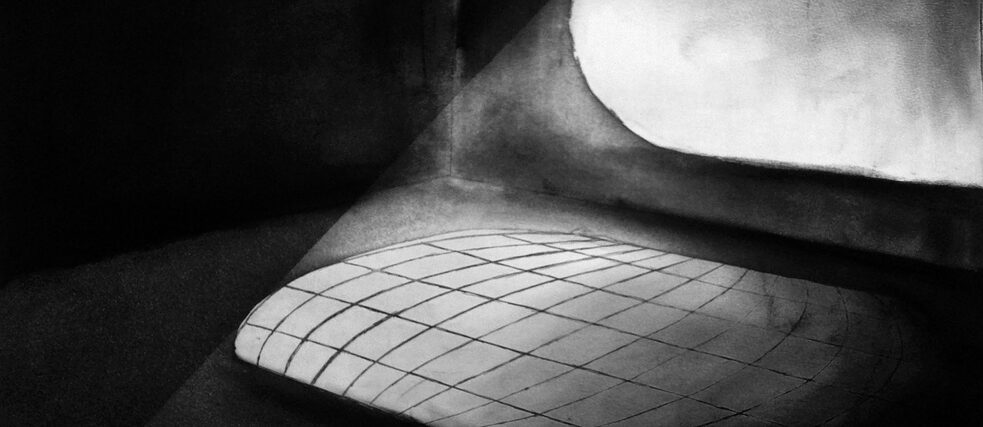
Gewalt ist ein in den Filmsprachen vieler lateinamerikanischer Länder allgegenwärtiges Element. Dies verweist darauf, dass sich die Geschichten und Identitäten in unterschiedlichen Regionen des Kontinents ähnlicher sind, als es auf den ersten Blick scheint.
Woran ließe sich der Kern einer lateinamerikanischen Identität festmachen? Wie auf vielen anderen Gebieten, ist auch im Film die Distanz zwischen Brasilien, diesem „großen anderen Geschwister“, und seinen Nachbarn enorm, ungeachtet vereinzelter Bemühungen wie der des 2016 verstorbenen brasilianischen Filmkritikers José Carlos Avellar, dessen bahnbrechender Aufsatz A ponte clandestina (dt.: Die heimliche Brücke) den Versuch unternimmt, das brasilianische Kino mit dem anderer Länder des Kontinents in Zusammenhang zu bringen.
Bei meinen Sichtungen für die jüngste Ausgabe des Filmfestivals Cine Ceará, das dem iberoamerikanischen Film gewidmet ist, konnte ich dennoch ein Element feststellen, dass das Kino der Region auf besondere Weise eint: die allgegenwärtigen Darstellungen von Gewalt. Diese scheint eine der Hauptklammern zu sein zwischen Filmen aus territorial, geografisch, kulturell und historisch so unterschiedlichen Ländern wie Brasilien, Uruguay, Bolivien, Guatemala oder Mexiko.
Diese Allgegenwärtigkeit von Gewalt ist womöglich sogar bis zu einem gewissen Punkt selbstverständlich, wenn man bedenkt, dass Gewalt einer der Gründungsaspekte dessen ist, was allgemein als die „Entdeckung“ jedes dieser Länder bezeichnet wird. Seit der Ankunft der Kolonisatoren haben überall in der Region Prozesse von enormer Gewalt ihre Spuren in den identitätsstiftenden Erzählungen und der Vorstellungswelt Lateinamerikas hinterlassen; etwa mit dem Genozid an der indigenen Bevölkerung, dem ausbeuterischen Furor der aus Europa nach Südamerika kommenden Eliten, der Gewalt während der Zeit der Sklaverei und der blutigen Erringung der jeweiligen „Unabhängigkeit“ der lateinamerikanischen Länder.
Verbrechen der diktatorischen Regime
Ein Aspekt jedoch eint das lateinamerikanische Kino noch mehr. Und der hat mit einer jüngeren Welle dieser Gewalt zu tun: den Staatsverbrechen in nahezu der gesamten Region, begangen von den diktatorischen Regimes im Laufe des 20. Jahrhunderts. Auch wenn unschwer zu erkennen ist, dass diese Regime auf historischen Situationen vor ihnen fußten - und viele Filme zeichnen diese Brücke mit großer Klarheit - macht es die Tatsache, dass sie erst vor relativ kurzer Zeit herrschten, aktuell besonders dringend, sich auf audiovisuellem Gebiet mit ihnen zu beschäftigen. Noch gibt es viele lebende Verweise auf die begangenen Staatsverbrechen, nicht nur im übertragenen Sinn, sondern vor allem in der Gestalt von Personen und Protagonisten, sowohl auf der Seite der Opfer als auch auf der Täterseite.In der Tat ist beeindruckend zu beobachten, wie häufig sich sowohl dokumentarische als auch fiktionale Erzählungen mit den Gräueln der lateinamerikanischen Diktaturen und deren Spuren in heutigen lateinamerikanischen Gesellschaften beschäftigen. Dies geht übrigens auch über das Universum des lateinamerikanischen Filmschaffens hinaus, wie der jüngste Dokumentarfilm des italienischen Filmemachers Nanni Moretti Santiago, Italia beweist, der dem Umfeld des Putschs gegen Salvador Allende 1973 in Chile und dem Entstehen einer Generation chilenischer Emigranten in Italien nachspürt.
Peru und Guatemala: unterdrückte Erinnerung, Massaker, Verschwinden
Viele der Filme lateinamerikanischer Filmschaffender sind jedoch umso schmerzhafter, als sie sich zu einem Großteil mit Erzählungen aus dem persönlichen oder familiären Umfeld befassen. Auf den Filmfestspielen von Cannes 2019 zum Beispiel wurde das lateinamerikanische Kino mit der begehrten Goldenen Kamera für das beste Langfilmdebüt eines Regisseurs ausgezeichnet. Der prämierte Film, Nuestras Madres (Our Mothers) des Guatemalteken Cesar Diaz, verweist schon im Titel auf das Thema Erbe und Verlust, in einer fiktionalen Geschichte, die eine Reihe von Schauspielern in deren realem Umfeld mit einbezieht.Der Film zeigt das Bemühen von Forschern und Ermittlern, materielle (wie etwa Knochen) wie auch nicht-materielle (wie unterdrückte Erzählungen oder Geschichten) Spuren eines völkermordähnlichen Prozesses von Vertuschung und Unterdrückung von Wahrheit zu finden. Diesen Zusammenhang greift auch ein anderer großer Dokumentarfilm aus Guatemala auf, La asfixia (dt.: Das Ersticken), in dem sich die Regisseurin Ana Bustamante ausgehend von der unterdrückten Erinnerung ihrer eigenen Familie auf die Suche nach Spuren ihres Vaters macht, an den sie so gut wie keine Erinnerung hat.
Bezeichnenderweise gibt es einen ähnlichen Dialog zwischen zwei Filmen, einer fiktional, der andere dokumentarisch, beide ebenfalls aus dem Jahr 2019, aber aus einem anderen Land, dessen Filmschaffen international im Allgemeinen wenig Beachtung findet: Peru. Mit ebenfalls großem Erfolg wurde in Cannes der Spielfilm Canción sin nombre (Song Without a Name) von Melina León gezeigt. In ihrem Film nähert sich die Regisseurin der Geschichte ihres Vaters, der als Journalist über Kinder recherchierte, die mit Wissen des Staats ihren Müttern weggenommen wurden.
Das gleiche Thema klingt auch in dem Dokumentarfilm La busqueda an, in dem die Regisseure Mariano Agudo und Daniel Lagares Personen aus kleinen indigenen Gemeinschaften im Landesinneren Perus in ihrem Bemühen begleiten, die Geschichte von Massakern und von verschwundenen Personen in den 1980er Jahren aufzuklären.
Chile und Brasilien: Kindheit, abwesende Eltern und eine Fehlgeburt
In Brasilien dagegen haben wir Filme, die versuchen, fiktionales Erzählen mit persönlichen Erinnerungen zu verbinden. Deslembro (Unremember, 2018) zum Beispiel basiert auf Kindheitserinnerungen der Regisseurin Flavia Castro und handelt vom Trauma der Rückkehr aus dem Exil. In ihrem Film schildert sie die Wiederbegegnung mit einem Land, das sie mehr aus der Vorstellung kannte und das sich nun als voller Stolperfallen für die Familie und die im Ausland aufgewachsenen Kinder erweist.In dem Film Fico te devendo uma carta sobre o Brasil (dt.: Ich schulde dir noch einen Brief über Brasilien) sucht die brasilianische Regisseurin Carolina Benjamin nach Spuren ihres Vaters im schwedischen Exil und unternimmt damit den Versuch, nicht nur den Mann zu verstehen, den sie als Tochter nie wirklich kennenlernte. Sie zeichnet auch nach, wie diese Zeit ihre Großmutter veränderte, die stets bei ihr war und von der großen Trauer aus der Zeit gezeichnet war, in der sie nach Spuren ihres Sohns suchte.
Die Notwendigkeit des Erinnerns und auch eines Endes der Trauer nach in Gefangenschaft erlittenen Traumata wirkt sich in dem in brasilianischer Koproduktion entstandenen chilenischen Dokumentarfilm Haydée y el pez volador (Haydée and the Flying Fish) auf die Familie noch anders aus. Die Regisseurin Pachi Bustos zeigt eine Protagonistin, die in Gefangenschaft infolge von brutaler Folter eine Fehlgeburt erlitt. Wiederum geht es hier um den Versuch, einen Abschluss zu finden, durchaus auch im juristischen Sinn, denn der Film begleitet ihren Kampf für die Verurteilung der Verantwortlichen, aber vor allem für die Befreiung der Vorstellungswelt einer Person, die, symbolisch durchaus auch auf das Land übertragbar, lebenslang am Gefühl eines Verlusts leidet, den sie nie beim Namen nennen konnte. Es ist auffällig, wie viele Filmemacherinnen sich in ihren Werken der Erinnerung und der Verschwundenen annehmen.
Einende Dringlichkeit
Die hier genannten Filme sind nur einige Beispiele aus lediglich vier Ländern, doch es fällt auf, wie sehr sie, obwohl durchaus unterschiedlich und geografisch weit voneinander entfernt entstanden, eine gemeinsame Fehlstelle bearbeiten. Es sind Geschichten von Vätern und Müttern, Großmüttern und Enkelinnen, die im Namen ihrer Länder das Empfinden eines gigantischen Unrechts in sich tragen, für das der jeweilige Staat nie in voller Konsequenz die Verantwortung übernommen hat. Eine durchaus erkennbare Nähe und zugleich ein vollkommener Unterschied zur Aufarbeitung der Nazizeit im deutschen Kontext.In einem Moment, in dem Brasilien sich einen Präsidenten gewählt hat, der offen die in jüngster Vergangenheit vom Staat ausgeübte Gewalt verherrlicht, erkennen wir deutlich, welche Gefahr von Ignoranz und historischer Mythisierung für die Zukunft unserer Länder ausgeht. Und wir verstehen noch besser den Grund für diese Dringlichkeit, die all diese unterschiedlichen lateinamerikanischen Filmsprachen eint: Nicht sprechen bedeutet vergessen; und vergessen heißt wiederholen. Viele lateinamerikanische Filmschaffende scheinen sich nicht zu Komplizen dieses Verbrechens an der Zukunft machen lassen zu wollen.
Kommentare
Kommentieren