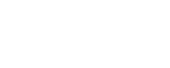3000 Jahre im „Perryversum“

Die erfolgreichste deutschsprachige Science-Fiction-Serie „Perry Rhodan“

Generationen von Lesern verfolgen die Abenteuer des Raumschiff-Commanders Perry Rhodan. Seit dem Jahr 1961 erscheint wöchentlich ein neues Science Fiction-Abenteuer am Kiosk, das den Namen seines Haupthelden trägt.
Im Jahre 1960 erarbeitete die NASA einen Langzeitplan für die Weltraumfahrt, der eine bemannte Mondumrundung vorsah. Ein Mensch auf dem Mond war damals noch pure Science Fiction. Stoff also für Band 1 der Perry-Rhodan-Serie: Unternehmen Stardust erschien etwa ein Jahr nach dem NASA-Plan. Die erste Mondlandung wurde darin von den Autoren Karl-Herbert Scheer und Clark Darlton (alias Walter Ernsting) ins Jahr 1971 datiert.
Auf dem Mond kommt der amerikanische Astronaut Perry Rhodan in Kontakt mit einer außerirdischen Zivilisation. Mithilfe deren Technologie verhindert Rhodan den dritten Weltkrieg und eint die zuvor in drei Machtblöcke gespaltene Menschheit. Außerdem erlangt er mithilfe eines „Zellaktivators“ die relative Unsterblichkeit. Das bedeutet, er altert nicht mehr. Auch Krankheiten können ihm nichts anhaben. Perry Rhodan kann aber sehr wohl durch äußere Umstände wie Gewalt oder Unfälle sterben.
Ordnung gegen Chaos
So weit, so gut… Die Handlung der folgenden etwa 3000 Jahre ist gekennzeichnet von interstellaren Konflikten, dem Kampf zwischen Ordnung und Chaos und öffnet sich esoterischen und philosophischen Inhalten. Das so entstandene Perryversum reflektiert damit auch die globalen Entwicklungen der realen Welt. „Es geht nicht um das klassisch Böse oder Gute, sondern um das vollständige Chaos oder den Stillstand der vollkommenen Ordnung. Dieser Widerspruch treibt oft die Handlung an, indem beide Seiten ganze Völker und Planetensysteme benutzen, um ihre Ziele zu erreichen“, erklärt Nils Hirseland vom Perry-Rhodan-Online-Club.

Am Erscheinungsbild der Heftromane hat sich im Laufe der Jahre nicht viel geändert. Aber natürlich ist an der erfolgreichsten deutschsprachigen Science Fiction-Saga die mediale Entwicklung nicht vorübergegangen. Mittlerweile lassen auch gebundene Ausgaben, Hörbücher und E-Books die Herzen einer treuen Leserschaft höher schlagen.
Um sich einen Überblick zu verschaffen, leisten mittlerweile unzählige Foren und Wiki-Projekte nicht nur Neulingen gute Dienste. Betreut werden diese Seiten von Fanclubs wie dem Perry-Rhodan-Online-Club. Dessen Vorsitz hat Nils Hirseland bereits 1998 übernommen. Damals war er noch nicht einmal 20 Jahre alt. Und auch heute ist der Mittdreißiger gut zehn Jahre jünger als der durchschnittliche Perry-Rhodan-Leser. „Ich bin da hineingewachsen. Die Erwachsenen in meiner Umgebung haben Perry Rhodan gelesen und so war es ganz normal, dass ich auch damit angefangen habe. Überhaupt bin ich ein Fan von Science Fiction aller Art“, so Hirseland.
(Con)geniale Zusammenarbeit zwischen Autoren und Fans
In Hirselands Fanclub stellen Männer die überwiegende Mehrheit. Einige Frauen wagen sich trotzdem in die vermeintliche Männerdomäne Science Fiction. Und im Autorenteam der Perry-Rhodan-Reihe schreiben (sogar) hin und wieder Frauen.
Übrigens besteht zwischen Autoren, Verlag und Lesern ein reger Kontakt. In jeder Perry-Rhodan-Ausgabe ist zum Beispiel ein großer Teil für Leserpost reserviert, die von zum Teil von den Autoren selbst beantwortet wird. Und auf den Zusammenkünften von Rhodan-Fans, den so genannten Cons, sind auch die Autoren Stammgäste. Diskussionen um neu eingeführte Figuren und technologische Entwicklungen im Perryversum werden geführt.
Da die erfolgreichste deutschsprachige Science-Fiction-Serie längst auch den internationalen Markt erobert hat, gab es neben den regionalen Cons seit 1980 sogar fünf Weltcons. Die letzte fand im Herbst 2011 anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Perry Rhodan in Mannheim statt.
Das Projekt, das ursprünglich auf etwa 30 bis 50 Bände angelegt war, ist zum Selbstläufer geworden. Übersetzungen und Fans gibt es in den USA, Brasilien, Russland, China Japan, Tschechien und vielen weiteren Ländern. Keiner im Verlag hatte sich 1961 einen derartigen Erfolg vorstellen können. Auch nach 51 Jahre, über 2600 Hefte und weit über 150.000 Seiten später ist ein Ende nicht absehbar.
Copyright: Goethe-Institut Prag
September 2012