Psychische Gesundheit
Kinder- und Jugendpsychiater sofort!

„Teilstationäre sollen wiederkommen“, hatte einer der Streikenden mit roter Farbe auf weißen Karton geschrieben. „Sie reißen Freundschaften auseinander“, „Wir fordern mehr Freiheit“, „Keine Therapie-Motivation wegen den neuen Regeln und Verboten“, lauteten andere Parolen.
Die Streikenden – zehn Patienten im Alter von 14 bis 18 Jahren – hatten Transparente über ihren Betten und auf dem Flur der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm angebracht. Sie forderten, dass ihre Mitpatienten aus der Tagesklinik, die aufgrund der Pandemie nach Hause geschickt worden waren, wieder in die Klinik zurückkehren dürften. Sie hatten die Transparente bereits am Abend aufgehängt, sodass die Ärzte und Therapeuten sie während ihrer Morgenvisite lesen konnten.
Von Magda Roszkowska
Es war März 2020, und Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte gerade den ersten Lockdown verhängt. Alle mussten sich an die neuen Kontaktbeschränkungen halten, auch die über ganz Deutschland verteilten 144 Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die meisten von ihnen, so auch die Klinik in Ulm, schlossen daraufhin ihre Tagespflegeeinrichtungen. Normalerweise bietet die Tagesklinik in Ulm zehn Behandlungsplätze für Kinder, die keine stationäre Behandlung, sondern eine tägliche Therapie benötigen. Die Tagesklinik ist von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr geöffnet. In dieser Zeit werden die Patienten einzel- und gruppentherapeutisch betreut und besuchen die klinikinterne Schule. Dort schließen sie auch Freundschaften mit ihren Mitpatienten in der Ganztagspflege.
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm besteht aus drei Abteilungen: einer Kinderstation mit zwölf Behandlungsplätzen für Kinder bis zum 14. Lebensjahr, eine Jugendstation mit acht Behandlungsplätzen für Jugendliche, die – zum Beispiel nach Selbstmordversuchen – dringend psychiatrische Behandlung benötigen, und eine weitere Jugendstation mit elf stationären und acht teilstationären Behandlungsplätzen für Jugendliche, die sich freiwillig in Behandlung begeben haben. Die Kinder und Jugendlichen wohnen in Zwei- oder Dreibettzimmern. Die Betten mit der buntgemusterten Bettwäsche assoziiert man nicht gerade mit einer Psychiatrie. An den Wänden hängen Poster und selbst gemalte Bilder, auf den Kopfkissen liegen Plüschtiere. Neben jedem der Betten stehen ein Stuhl und ein kleiner Schreibtisch, an dem die Kinder und Jugendlichen ihre Hausaufgaben machen können. Auch die Mensa wirkt sehr gemütlich. Die jungen Patienten sitzen jeweils zu sechst an einem Tisch. Beobachtet werden die Patienten von einer Löwenfamilie, welche als Wandgemälde zwischen den Fenstern hängt.
Während der Pandemie schlossen die Kliniken nicht nur ihre Tageskliniken, sondern reduzierten ebenfalls ihr stationäres Behandlungsangebot. In Ulm wurden die stationären Behandlungsplätze zunächst um 80 Prozent beschränkt und im späteren Verlauf der Pandemie wieder auf 90 Prozent erhöht. Zeitweise wurden nur noch Patienten mit extremen psychischen Störungen aufgenommen: Jugendliche, die selbst- oder fremdgefährdendes Verhalten aufwiesen, Selbstmordversuche hinter sich hatten oder an Magersucht oder psychotischen Zuständen litten. Es wurden kleinere Therapiegruppen mit je drei bis fünf Patienten gebildet. Eben diese besonders schwer erkrankten Jugendlichen hatten die Protestaktion für ihre Mitpatienten aus der Tagespflege organisiert.
 © Pexels, Oles Kanebckuu
© Pexels, Oles Kanebckuu
„Es ist in der psychiatrischen Behandlung wichtig, dass der Patient ein Gefühl der Handlungsfähigkeit hat und sich gehört fühlt“, erklärt Prof. Dr. Jörg M. Fegert, der ärztliche Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm. „Wir wollten den Protest nicht unter den Teppich kehren. Wir haben die Transparente fotografiert und die Krankenhausverwaltung sowie die lokalen Politiker über den Streik informiert. Sobald die Jugendlichen sahen, dass wir ihre Forderungen ernst nahmen, beendeten sie ihren Streik“, fügt er hinzu. Erst zwei Monate später wurde die Tagesklinik wieder geöffnet. In der Zwischenzeit wurden die Patienten online behandelt. „Sie haben seit Jahren dafür gekämpft, dass die Online-Therapie als wirksames Behandlungsverfahren anerkannt wird. Doch die Krankenkassen wollten nichts davon hören. Nach dem Ausbruch der Pandemie haben sie innerhalb einer Woche ihre Meinung geändert! Und das ist ein positiver Effekt der Pandemie, denn die Online-Therapie wird bleiben“, erklärt Jörg M. Fegert. „In einem Sprechzimmer fühlen sich die jungen Patienten oft eingeschüchtert. Bei der Online-Therapie besucht der Therapeut die Kinder über den Bildschirm direkt in ihrem Kinderzimmer. Und die Eltern müssen nicht kilometerweit in die Klinik fahren“.
Nicht überdramatisieren!
Als die Tagesklinik in Ulm im Mai 2020 wieder eröffnet wurde, begannen Forschende des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf eine Studie über die Auswirkungen und Folgen der Corona-Pandemie auf die seelische Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Zu diesem Zweck befragten sie mehr als 1000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 11 und 17 Jahren sowie deren Eltern mittels eines Online-Fragebogens. Im Januar 2021, während des zweiten Lockdowns, wurde die Befragung wiederholt. Die Ergebnisse waren alarmierend: Fast jedes dritte Kind litt unter psychischen Auffälligkeiten. Die Befragten zeigen zudem häufiger depressive Symptome sowie psychosomatische Beschwerden wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit oder Kopf- und Bauchschmerzen. Vor der Pandemie hatte dies nur auf jedes fünfte Kind in Deutschland zugetroffen. Mehr als 70 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen erklärten, sie fühlten sich durch die Corona-Krise seelisch belastet, und 40 Prozent sahen ihre Lebensqualität als niedrig an. Vor der Pandemie waren lediglich 15 Prozent. © Pexels, Mart Production
© Pexels, Mart Production
Währenddessen gab die Krankenversicherung DAK bereits Mitte des vergangenen Jahres eine Auswertung bekannt, nach der sich die Zahl der Psychiatrie-Einweisungen junger Menschen im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres fast verdoppelt hatte. Die Zahlen beruhten auf anonymisierten Daten von in Berlin lebenden Kindern und Jugendlichen.
„Einige meiner Kollegen berichten in der Tat, dass sie deutlich mehr Patienten haben als vor der Pandemie. Es gibt jedoch keine bundesweiten Statistiken, die eine solche Entwicklung belegen würden“, beruhigt Jörg M. Fegert.
Er erklärt, dass es in der Universitätsklinik in Ulm während der Pandemie zwar mehr Fälle von Depressionen, Angst oder Essstörungen gegeben habe, dafür jedoch deutlich weniger Patienten mit externalisierenden Störungen, die sich in Symptomen wie erhöhter Impulsivität, Aggression und destruktivem Verhalten äußern. Nach der Öffnung der Schulen sei die Zahl der letzteren rasch wieder angestiegen, was für Jörg M. Fegert nicht weiter verwunderlich ist, da diese Probleme vor allem vom schulischen Umfeld abhängen.
Ein Anführer mit Problemen
„Im Vergleich mit anderen Ländern geht es der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland sehr gut. Doch als jemand, der in diesem System arbeitet, erkenne ich nach wie vor viele Dinge, die geändert werden müssten“, erklärt Prof. Dr. Marcel Romanos, Direktor der Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Würzburger Universitätsklinikums und stellvertretender Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.Vor der Pandemie lag die Auslastung der Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland durchschnittlich bei 89 Prozent. 2019 gab es in den 144 Einrichtungen dieser Art 6 996 Behandlungsplätze, also durchschnittlich 48 pro Einrichtung. 140 dieser Einrichtungen boten – so wie die Universitätsklinik in Ulm – auch eine tagesklinische Betreuung an. 2019 wurden in den Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland über 60 000 Patienten betreut. Die Patienten bleiben durchschnittlich 36 Tage in stationärer Behandlung. Zum Vergleich: In Polen gab es im selben Jahr 40 Einrichtungen dieser Art mit 1039 Behandlungsplätzen, also durchschnittlich 25 Behandlungsplätzen pro Einrichtung. 37 dieser Einrichtungen boten auch eine tagesklinische Betreuung an.
2019 kamen in Deutschland auf die rund 13,5 Millionen Einwohner unter 18 Jahren 2538 Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Zum Vergleich: In Polen kamen auf die rund 7,5 Millionen Einwohner unter 18 Jahren nur 455 entsprechende Fachärzte, von denen lediglich 419 beruflich aktiv waren.
Marcel Romanos betont, dass die bundesweiten Statistiken nicht die Situation in den einzelnen Ländern widerspiegeln. Eine Versorgung mit Fachärzten ist nicht überall gewährleistet – am schwierigsten ist die Situation in ländlichen Gegenden. Deutschlandweit werden Patienten nur dann ohne Wartezeit aufgenommen, wenn deren Zustand eine sofortige Intervention benötigt. Andere müssen zwei bis zwölf Monate warten, je nach der Auslastung der Kliniken und der jeweiligen Jahreszeit. Am schlimmsten ist es zu Jahresbeginn.
 © Pexels
© Pexels
Nach Meinung von Experten ist das grundlegende Problem der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Deutschland eine zu späte Diagnose: Psychische Erkrankungen werden erst dann erkannt, wenn eine stationäre Behandlung bereits unumgänglich ist. Dabei sind die stationären Abteilungen und Tageskliniken lediglich ein Teil des psychiatrischen Versorgungssystems in Deutschland. Das System umfasst außerdem psychologische Beratungsstellen, in denen Psychiater, Psychologen, Sozialpädagogen und kassenärztlich zugelassene Psychotherapeuten arbeiten. 2019 waren in diesen Beratungsstellen 1236 Ärzte, also über die Hälfte sämtlicher Kinder- und Jugendpsychiater in Deutschland, tätig. Außerdem gab es 2019 in Deutschland rund 48 000 private Psychotherapeutinnen und -therapeuten – und jedes Jahr kommen durchschnittlich 2000 neue hinzu. Darüber hinaus gibt es in Deutschland ein breites Netz von psychologisch-pädagogischen Beratungsstellen, die vom Jugendamt finanziert werden und in denen überwiegend Pädagogen arbeiten. Diese Beratungsstellen haben die Aufgabe, Kinder und Jugendliche bei ersten Anzeichen einer psychischen Erkrankung an einen Facharzt zu überweisen. „Das Problem liegt darin, dass diese Beratungsstellen nicht genügend mit dem übrigen System vernetzt sind“, erklärt Marcel Romanos.
Eine Schule ohne Pädagogen?
Zum ersten Mal hörte Dorota ihre Tochter vor vier Jahren schreien, als das Mädchen sechs Jahre alt war. Sie hörte einfach nicht damit auf, also lernte Dorota, geduldig abzuwarten, bis sich ihre Tochter schließlich wieder beruhigte. Dorota überlegte lange, woran es liegen könnte, bis ihr schließlich klar wurde: Die Schreie ihrer Tochter kamen jedes Mal einen oder zwei Tage nach dem Besuch bei ihrem Vater, von dem sich Dorota vor einigen Jahren hatte scheiden lassen und mit dem sie sich nach wie vor das Sorgerecht teilte.„Geht es dir bei Papa gut? Ist er lieb zu dir? Besuchst du ihn gern?“, fragte Dorota ihre Tochter immer wieder, sobald sie von ihrem Vater zurückgekehrt war. Die Antwort war lange Zeit immer die gleiche: JA.
Dorota war wegen ihres Mannes nach Deutschland gekommen, eines in Deutschland aufgewachsenen Polen. Sie hatte sich von ihm getrennt, als sie jeden Morgen mit dem Gedanken aufwachte, welche Strafe sie heute wieder erwartete: Schweigen, Beschimpfungen, emotionale Erpressung, Erniedrigung.
„Er war ein schlechter Ehemann, aber ein guter Vater, zumindest wenn ich dabei war“, hatte sich Dorota gedacht und sich mit ihm auf geteiltes Sorgerecht für ihre Tochter geeinigt. Sie war in der Überzeugung erzogen worden, dass ein Kind sowohl eine Mutter als auch einen Vater braucht, um sich optimal entwickeln zu können.
Als ihre Tochter begann, ins Bett zu nässen, beschloss Dorota, professionelle Hilfe zu suchen. Sie unterhielt sich mit den Lehrern, doch die hatten nichts Auffälliges am Verhalten ihrer Tochter bemerkt, außer dass ihre Noten sich verschlechtert hatten. Dorota bat um ein Gespräch mit dem Schulpsychologen, doch an ihrer Schule gab es keinen. Sie erhielt die Telefonnummer eines Sozialpädagogen, der für mehrere Schulen in der Umgebung zuständig war. Er hatte nur am Montag Sprechstunde, und es war Dienstag, also wartete Dorota. Der Sozialpädagoge war bereit zu helfen, doch er benötigte dafür die Einwilligung beider Elternteile. Ihr ehemaliger Mann hielt es nicht für notwendig, dass seine Tochter sich mit irgendjemandem unterhielt, und als Dorota ihm das Besuchsrecht verweigerte, reichte er eine Klage beim Familiengericht ein. Das entsprechende Verfahren läuft bereits seit zwei Jahren. In der Zwischenzeit wurde das Besuchsrecht des Vaters auf acht Stunden pro Woche eingeschränkt, und der Richter überzeugte ihn davon, einer Behandlung seiner Tochter zuzustimmen. Sobald Dorota den Gerichtsbeschluss und die Überweisung von ihrem Hausarzt erhalten hatte, begann sie, sämtliche Kinderpsychiater in der Umgebung anzurufen. Doch es gab keine freien Behandlungsplätze. Verzweifelt wandte sich Dorota an die Krankenkasse. Dort vermittelte ihr ein Mitarbeiter innerhalb nur eines Tages einen Facharzt, dessen Praxis jedoch 30 Kilometer entfernt lag. Seit eineinhalb Jahren fährt Dorota mit ihrer Tochter einmal in der Woche zur Therapie, wartet eine Stunde im Auto und fährt wieder mit ihr zurück. Außerdem muss sie einmal in der Woche eine psychologisch-pädagogische Beratungsstelle aufsuchen. Das Gericht hat den Eltern zwei Familienberater zugeteilt, die ihnen dabei helfen, Entscheidungen bezüglich ihrer Tochter zu vereinbaren. Dorota ist erschöpft, doch sie ist glücklich darüber, dass es ihrer Tochter allmählich besser geht.
„Sobald mein ehemaliger Mann endlich der Behandlung unserer Tochter zugestimmt hatte, dauerte es nicht einmal zwei Wochen, bis die Therapie begann! Doch der Anfang war schwer gewesen. In der Schule wussten die Lehrer nicht wirklich, was sie tun sollten. Ich hatte den Eindruck, dass meine Fragen sie irritierten, dass sie keine Zeit für die Probleme meiner Tochter hatten. Dem Sozialpädagogen waren die Hände gebunden. Schließlich rettete uns eine Mitarbeiterin der psychologisch-pädagogischen Beratungsstelle, an die ich mich gewandt hatte, bevor der Fall vor Gericht ging. Immer wenn es meiner Tochter schlechter ging, empfing die Mitarbeiterin sie außerhalb der Sprechzeiten zu einem kurzen Gespräch“, erzählt Dorota.
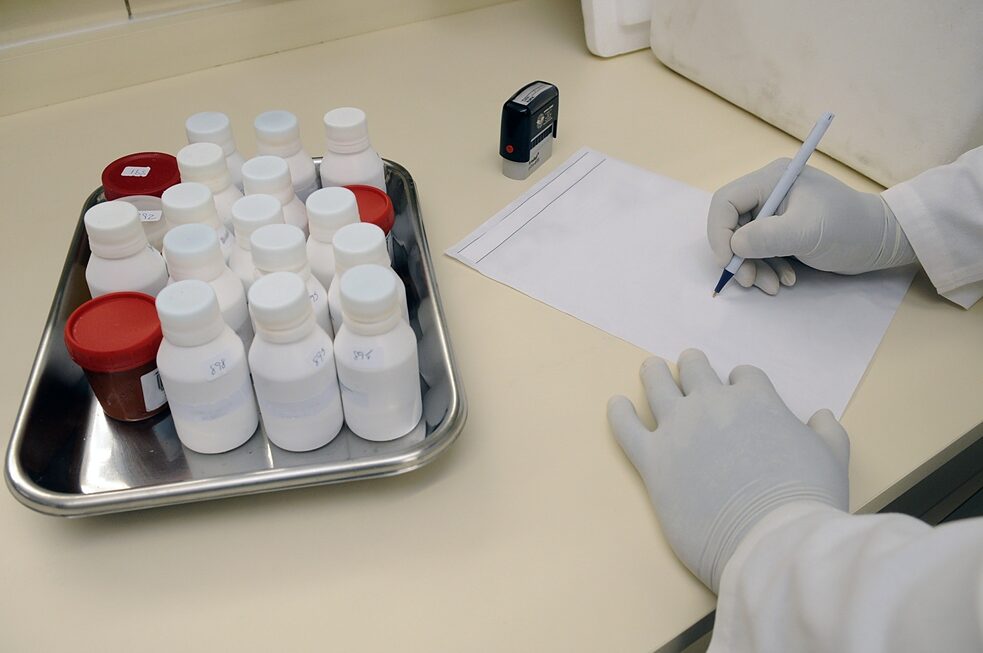 © Pexels, Pixabay
© Pexels, Pixabay
In einigen deutschen Bundesländern entwickeln Experten derzeit ein Projekt, das eine frühzeitige Diagnose und anschließende psychotherapeutische Behandlung im schulischen Umfeld vorsieht.
„Solche Projekte laufen bereits erfolgreich in anderen europäischen Ländern. In Deutschland ist das nach wie vor Zukunftsmusik“, erklärt Jörg M. Fegert, dessen Team bereits ein entsprechendes Konzept vorgelegt hat.
Die Psyche ist kein Auto, und eine Klinik keine Werkstatt
Ein Grund für die Überlastung der stationären Einrichtungen liegt darin, dass viele Patienten immer wieder in die Kliniken zurückkehren. Aus einer Studie der DAK geht hervor, dass 24 Prozent aller Kinder zwischen 10 und 17 Jahren, die aufgrund von Depressionen oder Angststörungen stationär behandelt werden, innerhalb von zwei Jahren rückfällig werden. Nach Ansicht der DAK liegt dies an der mangelnden ambulanten Nachsorge: Manche Patienten setzen die Behandlung überhaupt nicht fort, andere müssen zu lange auf einen Behandlungsplatz warten, und für wieder andere erweisen sich die ein bis zwei Termine in der Woche als nicht ausreichend.„Wir müssen uns klarmachen, dass sich psychische Störungen nicht so einfach reparieren lassen wie Defekte an einem Auto und dass psychiatrische Einrichtungen keine Werkstätten sind. Die Kinder und Jugendlichen kehren in die Kliniken zurück, weil dies in vielen Fällen einfach in der Natur ihrer Krankheit liegt“, erklärt Marcel Romanos. „Wir müssen nach alternativen intensiven Behandlungsformen außerhalb der Krankenhäuser suchen, um die stationären Abteilungen zu entlasten“, fügt er hinzu.
In dem von Prof. Dr. Romanos geleiteten Klinikum Würzburg wurde 2018 eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche eingerichtet, die sich selbst verletzten oder auf andere Weise ihre Gesundheit schädigen, aber nicht akut selbstmordgefährdet sind.
„Das sind schwer kranke Menschen, die man in vielen anderen Einrichtungen stationär behandeln würde. Aus unseren Erfahrungen geht jedoch hervor, dass eine stationäre oder teilstationäre Behandlung in ihrem Fall oft nicht notwendig ist. Wir bieten diesen Patienten eine kognitive Verhaltenstherapie an, die in mehreren einstündigen Sitzungen pro Woche stattfindet. Wir arbeiteten mehrere Monate intensiv daran, die Reaktion der Patienten auf konkrete Situationen und die durch sie ausgelösten Emotionen zu verändern. Die Ergebnisse sind vielversprechend“, berichtet Marcel Romanos.
Ein weiterer Ansatz ist die psychiatrische häusliche Krankenpflege. 2017 trafen einige deutsche Kliniken für Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Vereinbarung mit den Krankenkassen, die es ihnen erlaubte, einen Teil ihrer Patienten in deren häuslicher Umgebung zu behandeln, um lange Krankenhausaufenthalte zu vermeiden. Eine dieser Einrichtungen war die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Ulm, die von Beginn 2018 bis Mitte August 2019 58 minderjährige Patienten zu Hause behandelte. Die Therapie dauerte sechs Wochen und verlief genau wie eine Behandlung im Krankenhaus – mit dem Unterschied, dass die Psychiater, Psychotherapeuten und Beschäftigungstherapeuten die Patienten zu Hause besuchten. Die Kosten für eine solche Behandlung sind circa 1500 Euro niedriger als die Kosten für einen Krankenhausaufenthalt.
„Ich weiß nicht, wann wir wieder eine psychiatrische häusliche Krankenpflege anbieten können. Die Pandemie hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, und wir waren gezwungen, auf diese Form der Behandlung zu verzichten“, erklärt Jörg M. Fegert.
Therapie am Fließband
„Als ich das Krankenhaus verließ, stand ich kurz vor einem Burnout“, erinnert sich Katharina, die – ebenso wie 1700 andere deutsche Fachärztinnen und -ärzte – eine Weiterbildung im Bereich Kinder- und Jugendpsychiatrie absolviert. In Deutschland dauert eine solche Weiterbildung fünf Jahre, von denen drei in der unmittelbaren Patientenversorgung stattfinden müssen. „Die meisten von uns sind völlig überlastet. Neben den Seminaren und den Praxiseinsätzen müssen wir einen entsprechenden Basiskurs abschließen, eine psychotherapeutische Selbsterfahrung absolvieren und an Supervisionssitzungen teilnehmen“, berichtet Katharina.Sie arbeitete zwei Jahre in einem Berliner Krankenhaus und verlor, wie sie selbst sagt, nach und nach die Illusion, dass das Wohl der Patienten wichtiger ist als ökonomische Zwänge – was in der Praxis bedeutet, dass die Klinik so viele Patienten wie möglich aufnehmen muss. In der Regel betreute Katharina acht Patienten, die auf unterschiedlichen Stationen untergebracht waren. Jeder Tag glich dem anderen: Morgens besprach sie sich mit den diensthabenden Pflegerinnen, anschließend unterhielt sie sich mit den Patienten und deren Familien, führte therapeutische Sitzungen durch und aktualisierte die Krankenakten.
„Oft stellte sich im letzten Moment heraus, dass einer der Ärzte krank geworden war und man seine Patienten übernehmen musste, oder man musste einen zusätzlichen Nachtdienst übernehmen, weil ein anderer Arzt Urlaub genommen hatte. Ich war ständig im Stress und hatte keinen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, wie ich meinen Patienten am besten helfen könnte“, erinnert sie sich und fügt hinzu, dass das Schlimmste der ständige Druck war, immer und immer mehr zu übernehmen. „Irgendwann hatte ich keine Wahl mehr und schaltete einfach in den Überlebensmodus. Ich funktionierte wie ein Roboter“, erzählt Katharina. Als sie ihr Kind bekam, gab sie ihre Stelle in der Klinik auf.
Seit eineinhalb Jahren arbeitet Katharina in einer Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit psychischen Problemen – zusammen mit zwei weiteren Kinder- und Jugendpsychiatern, einem Psychologen und zwei Sozialpädagogen. Sie betreut 60 Patienten, doch diese werden überwiegend von privaten Psychotherapeuten behandelt, die mit der Beratungsstelle zusammenarbeiten. Katharina koordiniert den Behandlungsablauf, bewertet den Erfolg der Therapie und bespricht gemeinsam mit den Eltern die nächsten Behandlungsschritte. „Im Krankenhaus hatte ich nie genügend Zeit für meine Patienten. In der Beratungsstelle wurde ich für sie zu einer wirklichen Begleiterin – und das kommt mir sehr entgegen“, fasst sie zusammen. Um ihre Weiterbildung abzuschließen, muss Katharina jedoch für mindestens ein Jahr ins Krankenhaus zurückkehren.
Epilog
„Ungleichheiten in der psychiatrischen Versorgung junger Menschen gab es bereits vorher. Die Pandemie hat diese Ungleichheiten lediglich verschärft“ betont Jörg M. Fegert.„Was heißt das?“, frage ich nach.
„Familien aus der Mittelschicht haben sich immer früher an uns gewandt als Familien, in denen es Gewalt gibt, in denen die Eltern suchtkrank oder psychisch erkrankt sind, oder die sozial oder wirtschaftlich marginalisiert sind.
„Warum ist das so?“
„Weil Familien aus der Mittelschicht wissen, dass ihnen Hilfe zusteht. Bei den sogenannten Risikofamilien, muss oft erst ein Sozialarbeiter oder Pädagoge einschreiten und ihnen Hilfe anbieten. Ansonsten kommen diese Kinder entweder zu spät oder gar nicht zu uns.“
„Die Pandemie hat die Situation dieser Familien also noch verschärft?“
„Sie sind völlig von unserem Radar verschwunden. Wir wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich um diese Kinder kümmern.“
oto niemcy
Dieser Artikel gehört zu einer Reihe von Reportagen „Oto Niemcy“ (Das ist Deutschland), die das Goethe-Institut gemeinsam mit dem Magazin Weekend.gazeta.pl veröffentlicht.