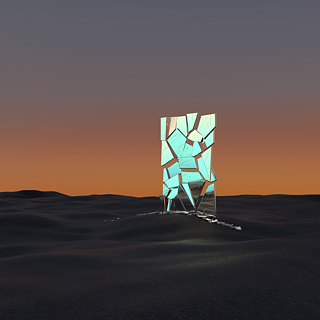An einem Sonntagvormittag sitzen mein Freund und ich auf meinem Sofa. Wir haben ausgeschlafen, trinken unseren Kaffee und lesen. Irgendwann pausiert er und fragt, ob er mir aus dem Buch, das er in der Hand hält, eine Stelle, die ihm besonders gefällt, vorlesen dürfe. In der Hand hält er Paul Austers New York-Trilogie. Den ersten Teil der Trilogie haben wir noch gemeinsam gelesen, bis wir gemerkt haben, dass der Sog, den diese Bücher ausüben, keinen Raum für die Geduld lassen, die nötig ist, um gemeinsam zu lesen. Er liest gerade den zweiten Teil, während ich mich einem anderen Buch widme. Wir sind uns einig, dass ein Teil des Sogs dieser Romane ausmacht, dass wir stetig als Lesende mit der Metaebene der schreibenden Person konfrontiert und ausgetrickst werden. Wir wissen nicht, wo sich die erzählende Instanz befindet, wer sie ist, inwiefern sie Teil des Erzählten ist und wann eine Geschichte anfängt oder aufhört. Die Fragen, die wir uns generell über Wirklichkeit und Fiktion, dem Schreiben als Arbeit und dem Selbst stellen, schrieb Auster klug in seinen Roman ein, so dass sich ein wechselhaftes Spiel mit der Wirklichkeit auftut. Die Stelle, die mir mit Begeisterung vorgelesen wird, handelt von der Realität, schriftstellerisch tätig zu sein. Es geht darum, dass Schreiben bedeute, die meiste Zeit nicht da zu sein. „Bei dir ist das aber nicht so, du bist schon da, oder?“, fragt mein Partner. Ich gebe ein unsicheres „Ja, ich bin hier“ von mir und denke danach, dass das nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Die inneren Bedingungen des Schreibens fordern eine gewisse Abwesenheit in der Welt, sie fordern, sich der Struktur der Sprache, die sich in uns aufbaut, hinzugeben, in einen ausschließlichen Beobachtungsmodus zu verfallen, alles andere auf Autopilot zu stellen. Für viele Schreibende scheint das Nachdenken über die eigene Tätigkeit etwas Essentielles zu sein (ich zähle mich selbst dazu). Manche machen es sich zur Aufgabe, sie in ganzen Büchern zu erkunden. Vielleicht, weil diese Tätigkeit ein offenes Feld ist und wir nicht genau wissen, wo wir hingehen, wenn wir sie ausüben.
Dieser Text ist eine Auftragsarbeit, in der ich aber nicht über die inneren Bedingungen des Schreibens nachdenken soll. Dieser Text soll sich mit den äußeren Bedingungen des Schreibens, nämlich den Arbeitsbedingungen des Betriebs befassen. Aufgrund meines Neuzugangs im Literaturbetrieb bin ich mir nicht sicher, ob ich etwas Neues sagen kann. Seit der Aufnahme dieser Arbeit kann ich allerdings nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie sich diese Arbeitswelt mit ihren Bedingungen und diese innere Welt des Schreibens zueinander verhalten. Ich würde sagen, dass sie sich oft als Gegensätze gegenüberstehen. Während das Schreiben im Rückzug geschieht, so passiert es im Literaturbetrieb, dass – wenn man gelesen und rezipiert werden möchte – man hinter dem eigenen Text hervorzutreten hat, sich präsentieren muss. In diesem Hervortreten ist mir oft nicht bewusst, als welche Person ich dort stehe und was mein Gegenüber von mir erwartet. Stehe ich als verlängerter Arm meiner Worte, als mein privates Ich, als ein Alter Ego, eine performative Inszenierung oder als Werbeinstrument meiner Selbst da? Oder ist es eine Kombination aus allem? Auch wenn ich auf diese Fragen keine Antworten habe, so ist es dennoch deutlich, dass der Literaturbetrieb – wenn es um die Schreibenden geht – auf Individuen ausgerichtet ist, und dementsprechend wird die eigene Person zum Teil eines vermarktbaren Produktes, das Ich zu einer Art Modelliermasse, die sich zu dieser Tatsache verhalten muss. Je nachdem, was verlangt wird und wo die eigenen Grenzen liegen. Und mit dem Fokus auf Individualpersonen liegt die Konkurrenz und das dementsprechende Verhalten nicht fern. Wie verhalte ich mich dazu, wie viel gebe ich von mir preis, wie viel Sichtbarkeit in Form meines Körpers und meiner Gedanken außerhalb des Geschriebenen möchte ich erhalten? Inwiefern sind Kollaborationen möglich? Solche Fragen müssen immer wieder gestellt werden und sie stehen dem in sich gekehrten Arbeiten entgegen. Sie erfordern eine nach außen gerichtete Wachsamkeit.
Diese Wachsamkeit scheint aber schon vor dem Auftritt gefordert zu sein. Sie beginnt mit den Aufträgen selbst. Obwohl es natürlich wünschenswert ist, für das Schreiben direkt, ohne sozusagen in Vorkasse gehen zu müssen, bezahlt zu werden, möchte ich dennoch nach dem Verhältnis von Auftrag und Text fragen.
Einen Auftrag erhalte ich von einer Institution. Für diesen Text wird ein Rahmen vorgegeben: Ein Thema, die Form, die Länge und zu guter Letzt die Frist zur Abgabe. Zudem hat jede Institution ein eigenes Profil, ein eigenes Publikum, das sich in den Vorgaben widerspiegelt. Mit meinem bezahlten Beitrag werden die Worte, die ich wähle, zu einem Beitrag, der auf die Bedingungen reagieren muss, der sie gegebenenfalls wortwörtlich in sich aufnimmt.
Was ich mit „Wachsamkeit“ versuche zu benennen, ist die Arbeit, sich durch die Rahmenbedingungen und damit durch die Strukturen von Institutionen zu navigieren, möglichst ohne dass jemand oder etwas anderes aus mir spricht als ich selbst.
Und das ist nicht einfach zu unterscheiden. Wann spreche ich, aus welcher Position spreche ich, für wen spreche ich, wen spreche ich an und wer spricht durch mich? Ich glaube daran, dass Literatur unter anderem die Aufgabe hat, sich nicht nach Strukturen richten, sondern gegen sie. Eine Kritik der Institution in sich zu tragen, anstatt in ihrem Namen zu sprechen. Auch das ist nicht einfach zu unterscheiden. Während ich diesen Text schreibe, schaue ich mir eine Festrede von Mely Kiyak aus dem Jahr 2016 an. An einer Stelle sagt sie: „Meine Aufgabe ist es zu benennen, was ich erkenne.“[1] Für mich bedeutet das auch, immer wieder die innere Schreibpraxis zu beobachten, sie sichtbar zu machen und damit eine Linie zu den äußeren Bedingungen zu ziehen: Den vereinzelten Plätzen bei der Vergabe von Stipendien und Preisen, die Selbstvermarktung, der Konkurrenzbetrieb, die üblichen Diskriminierungsformen, der Kanon, die mangelnde Diversität, die erschwerten Zugänge. Ob diese Trennung darin besteht, dann doch indirekt über anderes zu schreiben oder eine Deadline nicht einzuhalten, weiß ich nicht. Jedenfalls muss sie Versuche wagen, auf irgendeine Weise den Rahmen zu dehnen oder ihn sogar gänzlich zu sprengen.
[1] Mely Kiyak: Festrede im Rahmen der Verleihung der Otto Brenner Preise 2016, 15.11.2016,
https://www.otto-brenner-preis.de/fileadmin/user_data/preis/02_Preisjahrgaenge/2016/Preisverleihung/2016_Kiyak_Festrede.pdf (zuletzt abgerufen 19.12.2023).