Artificially Correct
»Einladung zum ‚Fest der Kränkungen‘» (krenkefest) - Über Konnotationen
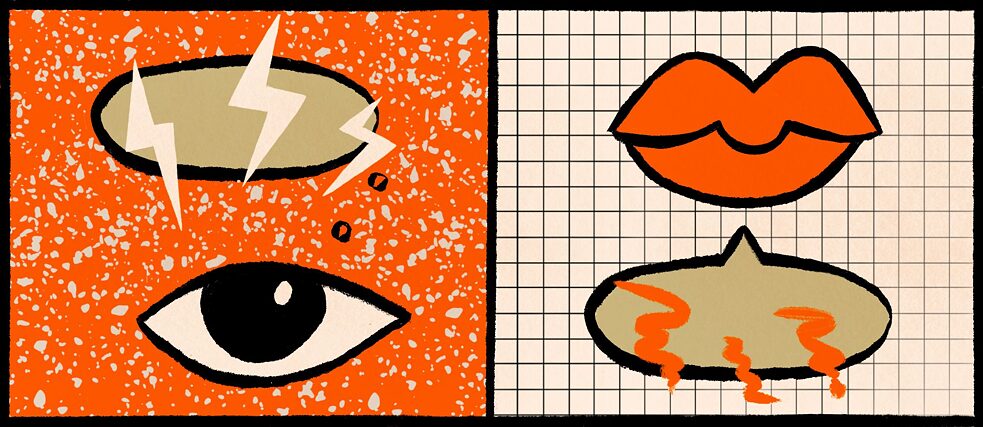
Wörter können unsichtbare Fallstricke nach sich ziehen, die Emotionen hervorrufen können. Beim Übersetzen kann man diese Fallstricke nicht einfach abschneiden.
Von Tove Andersson
Wörterbücher und Lexika üben eine große Macht bei der Definition von Begriffen aus, aber sie geben kein verbindliches Ergebnis vor. In Schlagzeilen und Kommentaren norwegischer Medien taucht aktuell der Begriff »krenkefest« (Fest der Kränkungen, Beleidigungen) auf, wenn eine Gruppe oder eine Einzelperson auf ein Wort reagiert.
Das Wort »krenkefest« ist ein Beispiel für ein solches Wort mit Fallstricken. Wir kennen Wörter, die gute Gefühle vermitteln (Pluswörter), Wörter, die negative Assoziationen hervorrufen und Wörter, die neutral sind. Einige haben bei demselben Wort unterschiedliche Assoziationen.
Es geht um das Recht, sich frei zu äußern, was auch Demütigungen und Beleidigungen einschließt, das im Gegensatz zu dem Recht steht, sich keinen Hassäußerungen aussetzen zu müssen. Das Wort krenke stammt vom mittelniederdeutschen krenken ‚krank machen‘ und kran ‘krank/schwach‘ über das nordische krankr (Norsk Akademisk Ordbok). Aber wenn das Store Norske Leksikon (SNL) Wörter ändert, geht es nicht um Angst vor Kränkungen.
Das N-Wort
Der Dokumentarfilm «I Am Not Your Negro» (2016), der auf dem unvollendeten Manuskript Remember This House von James Baldwin basiert, erzählt die Geschichte der USA anhand der drei berühmten Bürgerrechtler Medgar Evers, Malcolm X und Martin Luther King Jr.
Mit bis dahin unveröffentlichten Texten sowie Ausschnitten aus Filmen und der damaligen Berichterstattung schuf der Regisseur Raoul Peck einen packenden Essay über die historische Wirklichkeit der Afroamerikaner. Baldwin (1924-1987) kommentierte amerikanische Stereotypien folgendermaßen: „Es ist ein großer Schock, im Alter von fünf, sechs oder sieben Jahren zu entdecken, dass Gary Cooper Indianer ermordet; du hast zu Gary Cooper gehalten, aber du warst der Indianer.“
Der Film und seine Thematik sind noch immer aktuell.
Aber sagt man «Indianer»?
„Das Wort ist grenzwertig geworden und ist dabei zu verschwinden. Wir empfehlen, sparsam mit dem Begriff umzugehen“, meint Lotta Ederth, Beauftragte für Sprachpflege beim Schwedischen Radio im Gespräch mit Sveriges Nyheter.
Schwedischer Fernsehsender entschuldigt sich
2011 schrieb die Boulevardzeitung Expressen über einen unbekannten «Indianerstamm». Fünf Jahre später erhielt der Fernsehsender SVT Nyheter Öst nach einer Erwähnung von zwei «Indianerstämmen» Kritik und entschuldigte sich dafür.
Das Wort war stärker belastet, als sie glaubten.
Will man auf schwedischen Verkaufsseiten ein Buch mit einem Titelwort «Indianer» anbieten, wird es entfernt, nicht aber auf norwegischen Seiten.
Der «Språkrådet», das oberste norwegische Fachorgan für alle Sprachangelegenheiten, riet 2017 nicht davon ab, das Wort zu benutzen. 2017 schrieb er: „Wenn wir alle Änderungen und etwaige Missverständnisse beseitigen würden, hätten wir alle Hände voll zu tun.“
«Indianer» im Lexikon
Im selben Jahr bat eine Delegation der amerikanischen Urbevölkerung darum, das Wort «Indianer» aus dem Großen Norwegischen Lexikon, Store Norske Leksikon (SNL), zu entfernen. „Ich glaube, wir erhielten daraufhin rund 10.000 ziemlich wütende Kommentare in den sozialen Medien. Es sind viele weiße, ältere Männer, die das Gefühl haben, dass wir ihnen vielleicht bald ihre Kindheit wegnehmen. Sie befürchten, dass das Cowboy-und-Indianer-Spielen verschwindet“, berichtet Erik Bolstad von SNL. Den Lexikoneintrag «Indianer» gibt es noch immer, er führt aber weiter zu «Amerikanische Ureinwohner».
„Es geht uns um Genauigkeit und modernen Sprachgebrauch, nicht um politische Korrektheit“, äußerte sich Bolstad gegenüber der Tageszeitung Fædrelandsvennen. „Das Lexikon bestimmt auch nicht, welche Wörter von anderen Leuten benutzt werden ‚können‘ oder ‚sollen‘. Wenn jemand «Indianer» sagen oder schreiben will, kann er oder sie das tun – das Wort steht noch immer im Wörterbuch.“ (Lexikonblog SNL, 2017)
Wer hat das Recht zu definieren?
Im letzteren Fall war es ein Dialog, aber was geschieht, wenn wir aus unterschiedlichen Kulturen kommen, wenn wir den Begriffen unterschiedliche Werte und Bedeutungen beimessen?
„Ich habe mich zuerst als «Neger» definiert, dann als «farbig», dann als «schwarz»“, sagt Chuck D in dem Film «James Brown – Mr. Dynamite» und illustriert damit das Problem.
Im Dezember 2020 wurde ein Fußballspiel zwischen Istanbul Basaksehir und Paris Saint-Germain abgebrochen, als der vierte Unparteiische das «N-Wort» verwendete. Auf Rumänisch rief der Schiedsrichter «negru». Das Wort bedeutet nicht «Neger», sondern «schwarz». Aber warum werden schwarze Spieler nach ihrer Hautfarbe bezeichnet, weiße aber nicht? Rio Ferdinand, der früher für Manchester United spielte, meinte, dass Fußball dazu genutzt werden sollte, um Stellung zu beziehen. Er verwies auf die Millwall-Spieler und ihren Kniefall aus Solidarität mit der Black-Lives-Matter-Bewegung, während die Fans pfiffen.
«Reich an Melanin»
Die Organisation African Youth in Norway stellte sich in den 1990er-Jahren in einer Kampagne gegen Wörter wie «Neger», «Farbige» und «Mulatten» mit der Broschüre «Nenn mich so, wie ich will». Für den ehemaligen Leiter der Organisation, Thomas Talawa Prestø, Gewinner des Viken-Kulturpreises 2020, ist das Wort nicht neu. «Reich an Melanin» verwendete sogar Borghild Rud (1910-1999), die große alte Illustratorin der Buchklassiker Teskjekjerringa von Alf Prøysen. «Reich an Melanin» ist dennoch ein ziemlich neuer Ausdruck in Norwegen.
Als der Jazz nach Norwegen kam
Blackface-Unterhaltung zählte zur populären Unterhaltungskultur.
In seiner Dissertation «Charleston i Grukkedalen» (Nasjonalbiblioteket, 2019) sammelte Erlend Hegdal Zeitdokumente und beleuchtete auf 400 illustrierten Seiten ein vergessenes Kapitel der norwegischen Musik, Kultur- und Mediengeschichte. Das Buch beschäftigt sich mit afroamerikanischen Künstler*innen auf den norwegischen Bühnen im 19. Jahrhundert sowie im ersten Halbjahr des 20. Jahrhunderts. Die Illustrationen zeigen sowohl die Freude der Künstler*innen an der Musik als auch Rassismus. Das Nationalmuseum macht darauf aufmerksam, „dass die Bilder außerhalb dieses Kontexts, verletzend wirken können“.
Pippi Langstrumpf
In Schweden ersetzte man 1997 den «Negerkönig» im Zeichentrickfilm von Pippi Langstrumpf durch den König «kurre-kurre-dutt-kung». In Norwegen und Deutschland ersetzte man ihn mit dem «Südseekönig». Die Reaktionen darauf blieben nicht aus, aber seine Autorin Astrid Lindgren wollte das Wort bereits 1970 entfernen. Ihre Tochter, Karin Nyman, schrieb ein Vorwort zu den Büchern, in dem sie erklärte, warum das Wort «Negerkönig» benutzt wurde, änderte später aber ihre Ansicht. „Damals habe ich in meiner geschützten Welt gedacht, dass dieses N-Wort nur ein Wort ist, das zur Geschichte gehört und es ruhig stehen bleiben kann. Aber dann habe ich meine Meinung geändert, denn es ist leider ein Wort, das heute noch verwendet wird. Es schadet, und dann können wir es in den Pippi-Büchern einfach nicht behalten.“ (Quelle: Zeitung VG).
Neutral oder sensitiv
Finn-Erik Vinje, der 1936 geborene Professor für nordische Sprachwissenschaften, meinte 2002, dass „das Wort «Neger» in Norwegen traditionell nicht diskriminierend und somit eine neutrale Beschreibung ist. Die Wirkung kann man diskutieren“, so Vinje, „weil die ungewünschten Konnotationen sich schnell an die neuen Bezeichnungen anheften und das «Umtaufen» dann weiter fortgesetzt werden muss. Das nennt man politisch korrekt“. (Quelle: Den norske legeforening)
Språkrådet
Der norwegische Språkrådet wurde dafür kritisiert, ebenfalls die Meinung von Vinje zu vertreten, und änderte die Bezeichnung «neutral» in «sensitiv» ab. Bei den «sensitiven Wörtern» findet man Folgendes:
„Das Wort «Neger» ist ursprünglich nicht ausschließlich rassistisch, kann aber klar so verwendet und auch aufgefasst werden. Am besten ist es deshalb, andere Wörter zu wählen. Wenn es notwendig ist, z. B. bei der Übersetzung des englischen «black» oder «african-american», kann man entweder «schwarz» oder «afroamerikanisch» oder «afrikanisch-amerikanisch» verwenden. Auch «schwarzhäutig» wäre eine Möglichkeit.“
Nach positiven Anwendungsbeispielen sucht man vergeblich: «Negerarbeit, australischer Neger, Negersklave, Negerdiener, Neger vom Dienst, Schwanzneger.» Die Ausnahme ist das «Negrospiritual», das im Norsk Etymologisk Ordbok von Yann de Caprona (erschienen 2014) erwähnt wird. Dort steht auch:
„In vielen Sprachen bekam das Wort «Neger» die Bedeutung «schwarzer Sklave» und wird deshalb häufig als sehr abfällig empfunden, besonders wenn es von weißen Personen verwendet wird. Das muss vermieden werden.»
Das Dilemma der Übersetzer*innen ist es, die Fallstricke dieser Wörter zu erkennen.
Ein gutes Wörterbuch beschreibt zuerst den Begriff (Denotation), bevor es in Klammern dann Informationen zu negativen Nebenbedeutungen (Konnotation) hinzufügt.