Sprechstunde – die Sprachkolumne
Sprachlosigkeit
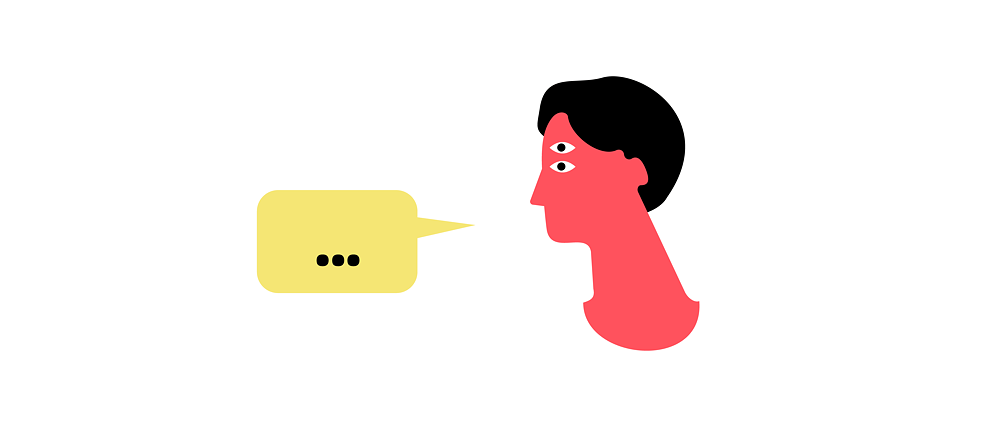
Angesichts allgegenwärtiger Wortfluten denkt Jagoda Marinić über die Kraft des Schweigens nach. Können nicht auch Pausen oder wortlose Gesten eindrucksvoll und ausdrucksstark sein?
Von Jagoda Marinić
Noch in der Sprachlosigkeit bemüht sich der Mensch um Sprache. Ich habe mich immer gefragt, weshalb ein Satz wie „Das macht mich sprachlos“ nicht dem Schweigen zum Opfer fällt, weshalb jemand trotz des Gefühls, dass kein Wort der Wirklichkeit gerecht wird, diese Lücke füllen muss. Muss man das Unzureichende an der Sprache aussprechen, statt sich und anderen diese Leere zuzumuten? Gäbe es nicht auch die Möglichkeit, Sprachlosigkeit zulassen, statt sie zu über-reden, oft unter Zuhilfenahme von Floskeln? Die Aufklärung, die alles ausleuchtet, scheint für das Schweigen keinen Platz geschaffen zu haben.
Die Macht der Pause
Dabei ist das Schweigen eine Sprache an sich. So wie die Stille, die daraus entstehen kann. Gleiches gilt für die Pausen innerhalb eines Musikstücks, zwischen Worten, zwischen zwei Menschen. Wie fühlt sich die Abwesenheit von Worten in Anwesenheit eines Menschen an? Schärft die Stille die Sinne, oder steigert sie das Selbstgespräch im Kopf, wodurch dem Schweigen im Außen ein rauschender Lärm im Innern folgte? Ich habe die Menschen, die ihre Pausen mächtig zu setzen wussten, meist mehr verehrt als jene, die eloquent ihre Gedanken zu äußern verstehen. Eloquenz ist ein Zeigen, das Schweigen hingegen ein Offenbaren – man überlässt demütig anderen, was sie sehen wollen. Für mich ist das die mächtigere Haltung. Die US-amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison verkörperte seine solche Haltung. Kaum ein Mensch sprach seine Sätze in derart durchdachter Stille wie sie. In ihrem Pausen hört man Essays. Vielleicht lese ich auch deshalb so gerne Gedichte, weil sie, wenn sie gut sind, eine so dichte Stimmung erzeugen. Irgendwann entsteht beim Lesen der Eindruck, jedes Wort mache die Stille hörbarer, in der das Gedicht vielleicht einmal entstanden ist. Überhaupt beginnt die Wirkung eines Gedichts erst nach seinem letzten Wort, wenn es ganz in den Leser gefallen ist.Sprechende Finger
Ich erinnere mich an eine Lesung in einer Kirche im Norden Deutschlands. Der 1943 geborene ehemalige Verleger des Hanser-Verlags Michael Krüger, der auch Dichter ist, las, bereits als alter Mann, eines seiner Gedichte in diesem riesigen Gebäude, vor wenigen totenstillen Zuhörern. Was noch zu tun ist, hieß das Gedicht meiner Erinnerung nach. Krüger saß auf einem Holzstuhl in diesem übergroßen Kirchensaal, seinen Gedichtband in den Händen, zählte seine Erlebenswünsche auf: Was sei angesichts der Zeit, die ihm noch blieb, zu tun? Zu leben? Er las vor, doch eigentlich sprach sein Körper, sprachen die Hände, die Finger, mit denen er einen Wunsch nach dem anderen abzählte. Eins, zwei, drei, vier … die Finger sagten nichts, doch werde ich ihre Sprache nicht vergessen. Bis heute erinnern mich diese einsamen Finger, an die der Dichter einen Wunsch nach dem anderen anheftete, daran, dass eines Tages im Leben eines jeden der Moment des Abzählens kommen wird. Dann stellt sich die Frage, was noch möglich ist. Glücklich sind die, die abzählen können.Gerade dort, wo ich mich sprachlos fühle, wo die Grenze des Sagbaren sein könnte, spüre ich die Intensität der Sprache am stärksten. Das Tasten nach den Worten, welche die Wirklichkeit, die einen umgibt, greifen könnten. In einer Zeit, in der Worte immer seltener aus der Stille kommen, sondern aus der kollektiven Wortflut, rauschen die meisten einfach nur vorbei. Viel Reden, und doch kaum ein Wort. Wir sollten uns der Sprachlosigkeit als Voraussetzung für Sprache bewusst sein.
Sprechstunde – Die Sprachkolumne
In unserer Kolumne „Sprechstunde“ widmen wir uns alle zwei Wochen der Sprache – als kulturelles und gesellschaftliches Phänomen. Wie entwickelt sich Sprache, welche Haltung haben Autor*innen zu „ihrer“ Sprache, wie prägt Sprache eine Gesellschaft? – Wechselnde Kolumnist*innen, Menschen mit beruflichem oder anderweitigem Bezug zur Sprache, verfolgen jeweils für sechs aufeinanderfolgende Ausgaben ihr persönliches Thema.