Gespräch mit Van Bo Le-Mentzel
Weniger Raum, aber mehr Freiheit und Phantasie

Van Bo Le-Mentzel ist ein Querdenker. Bekannt wurde der Architekt mit einfachen und günstigen Hartz4-Holzmöbeln zum Selbstbauen. Dann weitete er die Idee des demokratischen Designs aufs Wohnen aus, entwickelte Unterkünfte auf Fahrradanhängern und Tiny Houses auf Rädern.
Zuletzt gründete Le-Mentzel auf dem Gelände des Bauhaus-Archivs mit Gleichgesinnten einen temporären Campus aus Mini-Häusern, der als Dorf und Utopie neue Wohnkonzepte zur Diskussion stellt. Als wir uns Anfang Februar auf dem Gelände treffen, wird an einigen Häusern gemalert und geschraubt, Gruppen versammeln sich zum Architektur-Rundgang oder Planungs-Workshop. Le-Mentzel verbringt hier viel Zeit. Noch. Im März, wenn der von Volker Staab entworfene Neubau des Museums startet, muss der Bauhaus Campus schließen.
Van Bo Le-Mentzel, es ist ganz schön kalt, aber trotzdem wird überall gearbeitet.
Ja, ich staune selbst darüber, wie viel hier selbst im Winter bei Minusgraden passiert. Die Menschen sind engagiert, weil sie die Chance haben selbst zu gestalten. Der Bauhaus Campus war ein einjähriges Experiment, bei dem wir die Fragen stellten: Wie kann ein gerechteres Miteinander funktionieren? Wie können Menschen, die Arbeit, Gemeinschaft und Platz brauchen, diese Bedürfnisse im urbanen Raum realisieren?
Tagsüber nutzt ihr den Campus zum Arbeiten und für Workshops, nachts sind einige der Tiny Houses Notschlafplätze für Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben. Wie wurde dieses Konzept aufgenommen?
Das Museum war begeistert. Die Nachbarn auch, zum Beispiel von dem veganen Essen, dass es jetzt hier gibt. Mein Eindruck ist, dass wir kaum Feinde haben. Wir tun aber auch nichts, was man schlecht finden könnte: Wir nehmen niemandem was weg, wir enteignen niemanden. Und wenn hier rund um die Uhr Menschen sind, entsteht ein Raum der sozialen Kontrolle und es gibt weniger Kriminalität. Das Museum spart sich quasi einen Wachschutz.
Es ist so: In Deutschland ist Wohnen grundsätzlich verboten. Wenn Dir irgendwo ein Grundstück gehört, darfst Du da nur gelegentlich übernachten. Der erste Wohnsitz darf kein Hotel, keine Schule, keine Turnhalle, kein Truck und kein Museum sein. Es gibt nur eine einzige Ausnahme des deutschen Wohnverbotes: Eine Wohnung.
Und das siehst Du als Problem?
Keinen Wohnsitz zu haben, das heißt, in Deutschland nicht zu existieren. Du bekommst keine Steuernummer und kein Konto. Wir haben beispielsweise jemanden aus Kurdistan hier, der keine Papiere hat, weil Kurdistan juristisch nicht existiert. Warum muss er sich an unsere Normen anpassen? Käme allerdings das Ordnungsamt vorbei und wir erzählen etwas über die Philosophie von Grenzen, dann ist das die falsche Adresse. Deshalb sagen wir: Das ist alles Kunst. Und Forschung.
Siehst Du Dich als Architekt, Künstler oder Forscher?
Ich bin der Hofnarr. Ich weiß, dass die Leute die Häuschen niedlich finden. Mit ihren kleinen Veranden und Holzfassaden sehen sie aus wie eine gemütliche finnische Sauna. Aber das sind Trojanische Pferde mit einem sehr ernsten Gehalt. Es geht um Obdachlosigkeit, um Systemwandel, um Transformationsprozesse in der Gesellschaft. Wie sieht eine Welt aus, in der wir Wohnen und Arbeiten nicht mehr trennen? Wie können wir mit öffentlichen Ressourcen umgehen, mit Rathäusern oder Schulen, die nachts ungenutzt stehen?
Nicht viele Orte dürfen bisher umgenutzt werden. Was muss sich ändern?
Meine Idee für die Tiny Houses ist ein Parkausweis, mit dem sie überall in der Stadt abgestellt werden können. Damit meine ich nicht, dass jeder, der 50.000 Euro für ein Tiny House übrig hat, parken darf, wo er will. Sondern dort sollen diejenigen Raum finden, die sich mit Projekten für die Gesellschaft einsetzen: Nachhilfeunterricht, Kinderbetreuung, Food-Sharing, Bibliotheken oder Nachbarschaftskinos.
Also siehst Du die Tiny Houses nicht als Antwort auf Wohnungsverknappung und ansteigende Mieten?
Die Grundidee vielleicht. Aber wenn ein Anhänger in den Abgasen an der Straße steht, ist der keine Alternative zu einer normalen Wohnung. Aber eine Ergänzung. Ein Raum-Satellit, wie eine Garage. Eine Pufferzone zwischen komplett privat und komplett öffentlich, wo genau aus diesem Grund etwas anderes passiert, als im Büro oder der Wohnung. Ich sehe die Tiny Houses als Brücke zwischen ganz harten Nutzungen als Potentialräume.
Wie geht es für Euch weiter wenn ihr das Gelände verlassen müsst?
Wir wollen gar nicht wurzeln. Deswegen ist der Anhänger, auf dem die Tiny Houses sitzen, eine schöne Metapher: Wir hängen uns an die Nachbarschaft, an die Infrastruktur. Unser Projekt ist nicht für die Wüste gemacht, sondern dockt an den urbanen Raum an, wo wir mit Schwimmbädern, Toiletten, Stromnetz, Wasseranschlüssen oder dem Angebot öffentlicher Gebäude alles finden, was wir zum Wohnen in den Tiny Houses brauchen. Es gibt viele solcher Orte.
Was hast Du im letzten Jahr gelernt?
Ich habe viel über Freiheit gelernt. Und dass sie nur bedingt etwas mit Raum zu tun hat.
Wie wohnst Du selber?
Ich lebe mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in einer 56 Quadratmeter großen Wohnung. Wir gehen mit dem Raum intelligent um. Es ist doch so: Wir haben nicht zu wenig Wohnraum, wir haben zu wenig Phantasie.








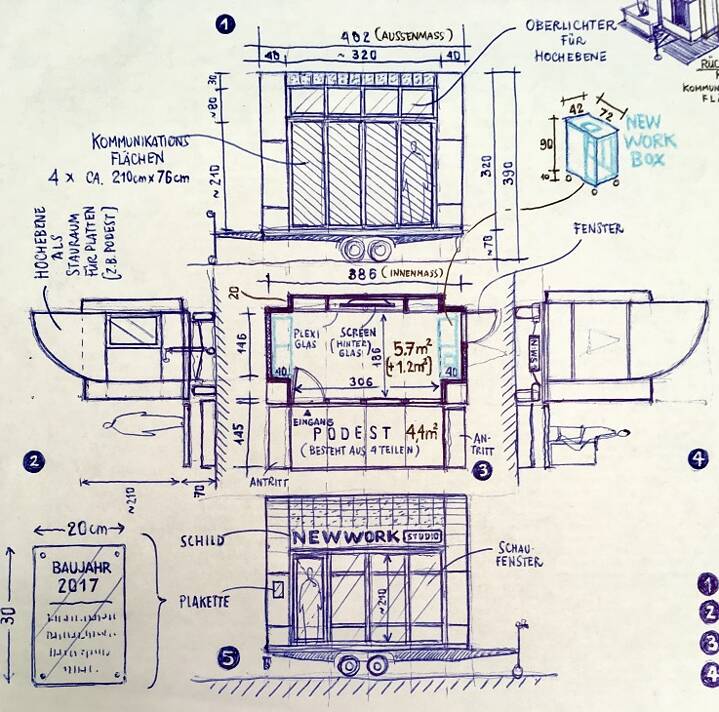


Kommentare
Kommentieren